Frachtblog

Zurück in der europäischen Realität.
Selbst in Corona-Zeiten helfen viele beim Löschen der Fracht
«Take out slack stern and bow!» «Holaway stern and bow!» «Hold stern, holaway bow!» Mit solchen Befehlen, die Lose aus den Taljen am Vor- und am Hauptmast herauszunehmen und dann gemeinsam oder teilweise nur auf der einen Seite zu ziehen, steuert der zweite Maat die schweren Rumfässer, die an Seilzügen aus dem Laderaum an Deck befördert werden. Dort wird dann der «Wip» angehängt, ein dritter Flaschenzug, der an der Nock der untersten Rah befestigt ist. «Holaway Wip!» bringt das Fass über die Reling auf den Steg, wo die Befehle folgen, langsam zu fieren, damit sich das Fass auf die bereitstehende Palette senkt.
Ein Delfin spielt mit seinen Rettern Katz und Maus
Doch bevor wir mit dem Entladen beginnen konnten, mussten wir den Delfin loswerden, der sich in der Bretagne der «Tres Hombres» angeschlossen hatte. Er ist dem Schiff auch durch die Schleuse in Ijnmuiden gefolgt bis an die Pier bei der Schokoladenfabrik. Dies war der Hafenbehörde nicht entgangen, und bald einmal stand ein Lieferwagen mit der Aufschrift «SOS Dolfijn» des International Fund for Animal Welfare (IFAW)auf dem Parkplatz. Dann kriegte die Presse Wind von dem Tümmler. Diese grosse Delphin-Art – bekannt aus den Flipper-Filmen und Delfin-Shows – kommt sonst nur westlich des Ärmelkanals vor. Bald war ein Fernseh-Team hier, der Delfin schaffte es in die nationalen Nachrichten. Später säumten FotografInnen mit langen Teleobjektiven oder auch nur dem Handy das Ufer, und bald mal hatten wir sie – Corona hin, Corona her – auch an Bord.

Der Delfin Zafar liebt unser Dinghi…
Indem er mit unserem Schiff durch die Schleuse geschwommen ist, hat der Meeressäuger vom Salz- ins Süsswasser gewechselt. Hier gibts Schwäne, Haubentaucher und Blässhühner, aber keine Meerestiere. Die Delfin-Rettungsorganisation konnte ihn anhand der Kerben in seiner Finne identifizieren, da sie über eine Datenbank alleinlebender Delfine verfügt: In Frankreich sei er unter dem Namen Zafar bekannt. Er verhalte sich vor allem gegenüber Frauen aggressiv, habe eine Schwimmerin daran gehindert, ans Ufer zurück zu kehren, so dass sie gerettet werden musste. Es werde spekuliert, dass Zafar ein entwichener Militärdelfin sei. In der Tat bilden die USA Delfine unter anderem für die Minensuche aus und haben diese 2003 im Golfkrieg eingesetzt. Allerdings befinden sich die Ausbildungszentren an der US-Westküste, was eine kriegerische Vergangenheit Zafars eher unwahrscheinlich macht. Andere gehen davon aus, dass er sexuell frustriert sei und sich deswegen zudringlich zeigt.

… und bekommt viel mediale Aufmerksamkeit.
Der erste Versuch, Zafar wieder ins Salzwasser zurück zu lotsen, scheiterte. Er liess sich zwar von unserem Dinghi weg begleiten, kehrte dann aber zurück. Die DelfinretterInnen hatten Bedenken, dass er wegen des Süsswassers gesundheitliche Probleme bekommen könnte. Deshalb wollten sie nicht warten, bis die «Tres Hombres» Mitte Mai nach Dieppe aufbricht, um französischen Wein nach Kopenhagen zu holen. Deshalb wurde das Schleppboot bestellt und wir legten ab, in Richtung Schleuse. Zuerst folgte Zafar uns und dem Boot von SOS Delfin brav, tauchte mal am Bug, dann am Heck zwischen dem Schlepper und der «Tres Hombres»auf, um Luft zu holen. Doch nach über einer Stunde, kurz bevor wir die Schleuse erreichten, entschied er sich für eine kleine Segelyacht, die unter Motor in der Gegenrichtung fuhr. Was in seinem Kopf vorgeht, blieb ein Rätsel.
Also hiess es umkehren. Das Boot der selbsternannten Retter folgte dem störrischen Meeressäuger zur Yacht und es gelang schliesslich, ihn zu überzeugen, wieder sich wieder der «Tres Hombres» anzuschliessen. Als wir die Schleuse erreichten, setzten wir das Beiboot aus. Zwei unserer Leute und die Mannschaft des SOS-Delfin-Boots versuchten, mit Geräuschen, Klatschen aufs Wasser und ins Wasser geworfenen Fendern Zafar zu überzeugen, er möge sich doch bitte bequemen, auch in die Schleuse zu kommen. Regelmässig liess er sich vor der Schleuse bei unserem Dinghi blicken. Sobald dieses aber das Schleusentor passierte, tauchte die Finne des Delfins mit Schwimmrichtung auswärts wieder ganz woanders auf. So einfach will sich ein Zafar nicht retten lassen!
Auf der Brücke über die Schleuse hatte sich mittlerweile eine beachtliche Zahl Schaulustiger eingefunden, offenbar von der Berichterstattung – die Aktion wurde von einem Privatsender direkt übertragen – angelockt. Als das störrische Vieh schliesslich doch in der Schleuse war und die Tore sich quälend langsam geschlossen hatten, ging auf der anderen Seite das gleiche Katz- und Maus-Spiel weiter. Immer wenn die Gummiboote ihn aus der Schleuse gelockt hatten, tauchte er plötzlich vor dem Bug der in der Schleusenkammer vertäuten «Tres Hombres» wieder auf. Schliesslich musste diese die Schleuse verlassen. Erst da gefiel es Zafar, sich ins Salzwasser zu retten. Am Ufer brandete Applaus auf.
Nun ging es darum, ihn so weit von unserem Schiff weg zu lotsen, dass wir ohne ihn in die Schleuse zurück kehren konnten. Dies gelang nur, indem wir unser Beiboot zurückliessen und ohne dieses die rund zweistündige Rückfahrt antraten.

Zafar als Medienstar: Ein so grosser Delfin zieht Schaulustige an.
Neben den vier Delfinrettern bei uns an Bord und den beiden Personen in ihrem eigenen Boot war permanent ein Schiff der Hafenbehörde und zeitweise ein Polizeiboot in die Aktion involviert. Auch auf dem Schlepper waren zwei Personen beschäftigt. Alle diese Kosten inklusive der Rückführung unseres Dinghis per Anhänger muss SOS Dolfijn berappen. Aber letztlich dürfte sich der Aufwand in Spendengeldern auszahlen: Zafar war ein PR-Geschenk des Himmels. Eine bessere Gelegenheit, sich an einem Sonntagnachmittag in einem dicht besiedelten Umfeld derart in Szene zu setzen, kann sich eine Tierschutzorganisation kaum vorstellen. Für Fairtransport und die Tres Hombres ist dabei nicht viel abgefallen: In den auf Youtube aufgeschalteten Berichten wird der Name des Schiffs nicht erwähnt. Aber einer der Beiträge hat´s in zwei Tagen auf über eine Viertelmillion Klicks gebracht. Wäre Zafar dagegen ein Wolf oder ein Bär, dann wäre er mit seinem Verhalten als Problemtier erschossen worden. Der Mensch verteilt seine Sympathien äusserst ungleich.
Als ich die Retter-Chefin darauf ansprach, dass das eigentliche Problem nicht ein individuelles Tier sei, sondern dass jeder dritte Meeressäuger wegen des Welthandels und dem Lärm der Schiffe unheilbare Gehörschäden habe, stimmte sie mir zu: Die Tiere seien gestresst. Dies lasse sich messen. Derzeit sei wegen der Corona-Krise der Seeverkehr ähnlich stark reduziert wie nach 9/11. Beide Male seien in den Proben, die man den Tieren entnimmt, die Stresshormone deutlich zurück gegangen. Ihre Organisation IFAW betreibe deshalb auch Aufklärung und rufe dazu auf, mehr lokale Produkte zu kaufen.
*
Nachtrag Ende Mai: Wenige Tage nach der Aktion wurde Zafar tot mit fehlender Schwanzflosse an der holländischen Küste angeschwemmt. Die Obduktion an der Universität Utrecht ergab, dass vermutlich eine Schiffsschraube ihm den Schwanz abgetrennt hat.
Zafar war bereits früher ein Medienstar. So hatte die «Washington Post» im August 2018 über das wegen Zafar ausgesprochene Badeverbot an der französischen Westküste berichtet und ausführlich Experten zitiert, die sein Verhalten kommentierten: Delfine, die den Anschluss an ihre Gruppe verloren haben, würden als «sozial Ausgestossene» häufig den Kontakt zu Menschen suchen. In der Brunst würde sie sich dann an Menschen, Bojen oder Schiffen reiben. Durch den Kontakt zu Menschen verlören sie das Gefühl für Gefahren, die von Menschen und Schiffen ausgehen. Das Beste für sie sei, sich möglichst von ihnen fernzuhalten, damit sie ihr natürliches Verhalten wiederfinden. Für Zafar endete dies tragisch: Vermutlich wäre es ihm besser ergangen, hätte man zugewartet, bis er mit der «Tres Hombres», die keinen Motor und somit auch keinen Propeller hat, zurück in seine Heimat geschwommen wäre.
*
Verbündete Schokoladen-Macher
Am Dienstag luden wir dann den Kakao für die Chocolate Makers aus. Daraus wurde zwar keine Party wie in anderen Jahren, aber eine Reihe früherer MitseglerInnen und Fairtransport-Sympatisantinnen erschienen, so dass die 10 Tonnen deutlich schneller an Land waren als wir sie in Boca Chica geladen hatten.
Der mit der «Tres Hombres» transportierte Kakao aus der Dominikanischen Republik reicht für rund ein Drittel der Produktion von Chocolate Makers. Die Firma bezieht prinzipiell nur Kakao von Kooperativen, unter anderem aus dem Konfliktgebiet im Ost-Kongo. Dort gehe es darum, den Menschen ein legales Einkommen zu verschaffen, damit sie nicht in den nahen Virunga National-Park eindringen, einem Rückzugsgebiet für Gorillas. Gesüsst wird die Gorilla-Schokolade dann mit Zucker aus einem ähnlich gelagerten Orang-Utang-Schutzprojekt in Indonesien. Das ganze Dach der kleinen Fabrik besteht aus Solarzellen. Da diese mehr Strom liefern als aktuell für die Maschinen nötig ist, wollen die Schokladen-Macher in Zukunft Wasserstoff herstellen, um das Heizgas zu ersetzen, mit dem man bisher die Kakaobohnen röstet.
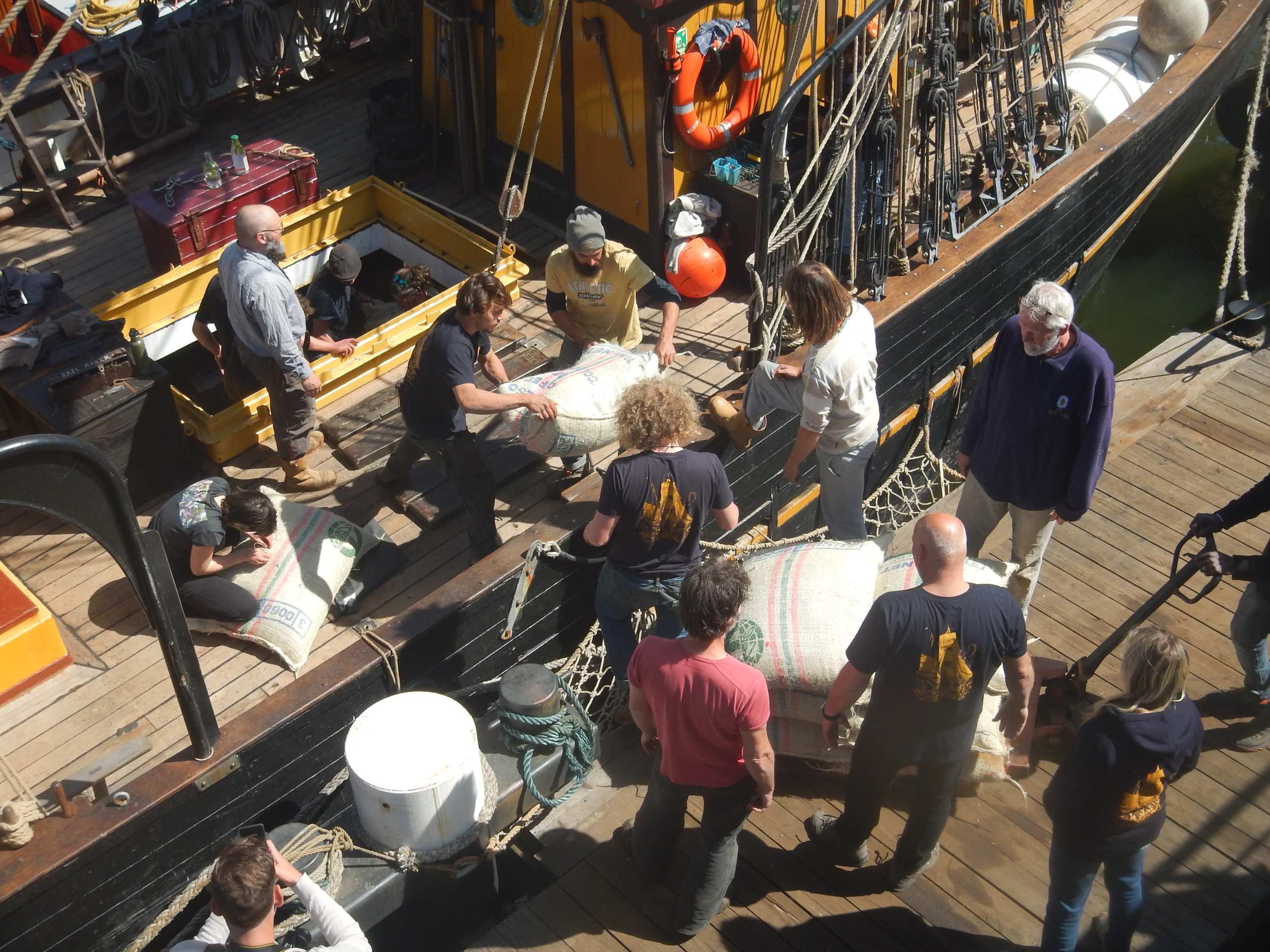
Auch die Kaffee-Bohnen für Selecta werden von Freiwilligen entladen.
Ein Gärtner und ein Multi
Unter den Fässern, die wir dann am Mittwoch entluden, waren auch die beiden für die Schmuzli GmbH im Baselbieter Hölstein. Diese betreibt in Pratteln das «Pflanzen-Paradies Vivero». Rum im Gartenbau-Geschäft? «Seit einem halben Jahrzehnt ist Rum aus der Dominikanischen Republik, der von der Tres Hombres transportiert wird, unser Hobby», erklärt Inhaber Kurt Gensetter. Aus alten Planken der «Tres Hombres» lässt er Deko-Artikel fertigen. Und eigentlich hätte er sich einen Zwischenhalt in Madeira gewünscht, um von dort einen Likör transportieren zu lassen. «Aber es hat nicht geklappt.»
Sind die Gärtner aus Pratteln alte Stammkunden mit Kleinmengen, so ist Selecta aus dem bernischen Kirchberg ein neuer Auftraggeber, der in einer ganz andere Liga spielt: Ja richtig, dies ist die Firma mit den Automaten an den Bahnhöfen. Selecta ist der erste in 16 Ländern tätige Konzern, der probeweise fünf Tonnen Kaffee aus Kolumbien mit der «Tres Hombres» segeln lässt und dafür auch die PR professionell aufzieht: Der Marketing-Beauftragte für Holland, Mischa Zwaan, kommt mit einem Kamerateam an Bord. Der Kaffee werde nicht an den Automaten erhältlich sein, er werde in Holland geröstet und sei für Firmenkunden bestimmt, die mehr als die Hälfte des Umsatzes von Selecta ausmachen . Um den ganzen Transport möglichst emissionsfrei zu organisieren hat Selecta einen LKW mit Wasserstoff-Motor bestellt. Da aber unklar war, wann das Schiff eintreffen wird, sei dies eine Herausfoderung, meint Zwaan. Als der Ausladetermin endlich feststeht, ist der Wasserstoff-LKW anderweitig im Einsatz. Deswegen wird der Kaffee im Hafen auf einer alten Fähre zwischengelagert.
Verfolgt Selecta den Transport unter Segeln weiter, dürfte dieser in eine neue Phase eintreten: War diese von dem Pionierschiff «Tes Hombres» begründete Branche bisher weitgehend auf Nischen der Fairtrade-, Bio- und Alternativwirtschaft beschränkt – beispielsweise die Chocolate Makers –, so interessiert sich nun grosses Kapital dafür. Die ursprünglich schweizerische Selecta gehört seit 2015 der Beteiligungsgesellschaft KKR aus New York. Diese ist darauf spezialisiert, mit Fremdkapital Firmen zu kaufen, diese profitabel zu trimmen und sie nach einigen Jahren mit Gewinn wieder zu abzustossen. Dafür sollte Selecta im letzten Jahr an die Börse gebracht werden, was dann aber abgeblasen wurde. KKR bezeichnet sich selbst als «führendes globales Investement-Unternehmen» mit einem Portfolio im Wert von über 200 Milliarden Dollar in einem breiten Spektrum von Branchen. Darunter sind Investitionen beispielsweise in den deutschen Axel-Springer-Verlag, in Pipelinefirmen oder die Fracking-Gas-Firma Quicksilver-Ressources.
Es besteht also ein Widerspruch zwischen den Aktivitäten des derzeitigen Eigentümers von Selecta einerseits und der welthandels- und klima-kritischen Fairtransport-Philosophie sowie der entsprechenden Stimmung an Bord der «Tres Hombres» andererseits. Ein weiterer Gegensatz besteht zwischen der Finanzkraft eines Grossinvestors, der Firmen einkauft wie andere Leute Hemden oder Hosen, und der offensichtlichen Geldknappheit bei Fairtransport, die sich nicht zuletzt in mehrfach geflickten Segeln zeigt, deren Stoff so spröde geworden ist, dass ich mich beim Nähen fragte, wie lange das wohl halten wird.
Andererseits muss die Idee des Transports unter Segeln – wenn sie eine klima-relevante Grösse werden soll – raus aus der Alternativnische. Dafür ist ein Kunde wie Selecta ein wichtiger Schritt: Wenn eine Firma mit Milliardenumsatz sich für Transport unter Segeln interessiert, dürfte dieser künftig auch von anderen Unternehmen ernster genommen werden. «Selecta ist aktuell daran, ein gesamtheitliches Konzept umzusetzen, um weitere CO2-Emissionen zu senken.
Dazu gehört auch der Transport unter Segeln», schreibt Selecta-Sprecher Yves Käser auf Anfrage. Mit diesem ersten Transport habe Selecta «durchwegs positive Erfahrungen gemacht». Der Kaffee werde aber nur in den Niederlanden erhältlich sein, wo es «ganz klar einen Markt für gesegelten Kaffee» gebe.
Im Gegensatz zum Kakao am Dienstag dauert das Löschen der Fracht bei einem Künstlerzentrum im hinteren Hafen von Nord-Amsterdam den ganzen Tag: Nach dem Kaffee für Selecta geht´s an den Rum. Stundenlang gehorcht ein Fass nach dem anderen den drei Flaschenzügen und wird auf den LKW verladen, der den Rum in den Zollfreihafen bringt. Dann sind der Kakao für La Flor aus Zürich und der Zucker für Pronatec aus Winterthur an der Reihe – sie werden direkt von einer Spedition abgeholt – bevor nach dem Essen die unterste Lage Fässer unter präzisen Kommandos an Land spediert wird. Die in der Kabine der Köchin untergebrachten Kartons mit einem Kakao-Zwischenprodukt folgen als letzte, bevor um halb sechs der Ruf «die Tres Hombres ist leer» erschallt und die zahlreichen HelferInnen in Jubel ausbrechen: Das Fest kann beginnen.

Die «Tres Hombres» als Teil einer Kunst-Aktion
Kinder bemalen alte Segel
Zwischendurch entführt mich die Malerin Hetty van der Linden in eine nahe gelegene alte Werfthalle, in der alte Segel ausliegen. Diese lässt sie von Schulkindern mit deren Zukunftswünschen bemalen. Daraus lässt sie Taschen nähen, die dann die Stadtverwaltung von Amsterdam mit Fairtransport-Artikeln gefüllt an Weihnachten verschenkt. «So wird die Tres Hombres bekannter und die Kinder werden auf die Probleme auf den Ozeanen aufmerksam», erklärt die Künstlerin. Die Amsterdamer Schulkinder bekommen für ihre Arbeit eine symbolische Aktie der «Ceiba», dem Fracht-Segelschiff, das eine befreundete kanadische Organisation derzeit in Costa Rica baut: «Ist dieses später auf den Ozeanen unterwegs, dann wissen die Kinder, dass sie selbst Teil eines Zukunftsprojekts sind.»
Da ist es selbstverständlich, dass die «Tres Hombres» ein gemaltes Segel von «Sail a future» setzt, wenn sie durch den Hafen von Amsterdam geschleppt wird. «Sail a future» ist Teil von «Paint a future» : Künstler aus zehn Ländern integrieren die von Kindern in der ganzen Welt gezeichneten Zukunftswünsche in ihre Bilder. Der Erlös aus deren Verkauf wird dann für Projekte unter anderem für Strassenkinder verwendet.

«Clean Seas» – nur ein Kinderwunsch?
Die Fragen anders stellen
Natürlich ist die Idee, im 21. Jahrhundert Fracht mit einer Technologie aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zu transportieren, auf den ersten Blick unrealistisch, illusionär, verrückt. Doch bei näherem Hinsehen spricht vieles dafür:
Erstens bleiben so Wissen und Erfahrung erhalten. Die Beispiele verlorener Erfahrung sind lang: So hat mir ein Vertreter des Schweizer Ziegelei-Museums berichtet, man wechsle heute bei alten Burgen jahrhundertealte Ziegel aus dem Mittelalter aus. Die neuen Ziegel, mit denen man sie ersetzt, hätten aber eine Lebenserwartung von wenigen Jahrzehnten. Wie man im Mittelalter diese hohe Qualität erreicht hat, das wisse man nicht mehr. Oder die Baukunst der früheren Zimmerleute, die Dachstühle oder den Rumpf von Windmühlen aus harten Eichenbalken bauten, die sie mit dem Beil bearbeiteten. Heute würde man so etwas am Computer berechnen und die Daten auf den CNC-Automaten schicken. Klappt wunderbar – bis mal der Strom weg ist. Dann fehlt das Erfahrungswissen, das in den Köpfen, Armen und Handgelenken der Zimmerleute steckte. Dieses Schicksal soll der Schifffahrt nicht widerfahren: Organisationen wie Fairtransport holen die Rahsegel-Kultur aus dem Museum in die reale Wirtschaft zurück.
Zweitens widerlegt man so die Mär, die Lösungen der Klimaprobleme seien nur oder vor allem in zukünftigen Technologien zu finden. Nichts gegen Innovation und Forschung. Doch oft genug müsste man nur die Anforderungen an eine Dienstleistung etwas modifizieren, die finanziellen Rahmenbedingungen ändern, die Profiterwartungen mässigen, und schon ginge es auch mit bereits bekannter Technik. Würde man die Anforderung lockern, dass Lieferungen um jeden ökologischen Preis «just in time» ankommen und in den Häfen tonnenschwere Container im Minutentakt geladen oder gelöscht werden müssen, dann liesse sich vieles unter Segeln transportieren. Das hätte zwar finanzielle Konsequenzen: Das Kapital wäre länger in den transportierten Waren gebunden. Und die neusten Handys wären wegen Flaute oder Sturm vielleicht nicht rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft in den Läden. Doch ist es verhältnismässig, für solche Kriterien die ozeanischen Ökosysteme aufs Spiel zu setzen?
Eine zentrale Botschaft der «Tres Hombres» ist also, dass Lösungen nicht nur eine Frage der Technik sind. Vieles kann man durch wirtschaftliche und insbesondere soziale Organisation erreichen – auch mit «antiquierter» Technologie. Soziale Organisation lässt sich allerdings nicht verkaufen, lässt sich nicht in der Buchhaltung beziffern. Technik hingegen schon, sie senkt Kosten und bringt Umsatz. Deshalb orientiert sich die Wirtschaft heute weitgehend auf technische Lösungen. Es braucht aber beides: Technik, die sich intelligent an gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert, und eine gesellschaftliche Organisation, die sich an die Grenzen hält, die der Planet Erde der Menschheit nun mal setzt.
Zusammengefasst: Selbst zukünftige Technologien werden nicht ausreichen, bis 2050 den CO2-Ausstoss der Frachtschiffe auf Null zu senken. Die immer dringlicheren Berichte des Weltklimarats zeigen, dass wir keine Zeit haben, noch lange Technologien entwickeln und im globalen Massstab die dafür notwendigen Infrastrukturen aufzubauen. Und das prognostizierte Wachstum des Transportvolumens auf das Drei- bis Vierfache erträgt der Planet erst recht nicht. Bereits der Umfang des heutigen Welthandels liegt jenseits des nachhaltig Verträglichen, wie wir im Denknetz-Jahrbuch 2019 «Welthandel und Umweltzerstörung» gezeigt haben.

Zwar gedämpft, aber auch in Zeiten der Corona ist das Löschen der Fracht ein festlicher Anlass.
Es kann also nicht darum gehen, technische Lösungen für das «Weiter wie bisher» zu finden. Vielmehr stellt sich die Frage, welcher Welthandel, welche Warentransporte effektiv nötig und sinnvoll sind. Wie weit muss der Welthandel, der bis zu 90 Prozent auf dem Meer stattfindet, reduziert werden, damit er mit verfügbarer oder rasch marktreifer Technik weitgehend emissionsfrei abgewickelt werden kann? Dabei wird Windkraft, also die Frachtsegelei, eine wichtige Rolle spielen: Für Segelschiffe ist kein Netz von Tankstellen für neuartige Treibstoffe erforderlich, für die noch nicht einmal die Fabriken gebaut sind. Die Segeltechnik ist im Grundsatz seit Menschengedenken bekannt. Sie ist zudem offen für Verbesserungen, lässt sich mit modernen Mitteln optimieren. Das heute weltweite Netz an Wettersatelliten und -stationen ermöglicht intelligente Wind-Vorhersagen und eine entsprechende Routenwahl. Und für alle, die es digital mögen: Segeldrohnen sammeln autonom Daten auf dem Meer und werden über Satellit gesteuert. Die Universität Plymouth entwickelt ein Schiff, das autonom, ohne einen Menschen an Bord, 2020 von England aus auf der Route der historischen «Mayflower» über den Atlantik segeln soll. Daraus gewonnene Erkenntnisse könnten künftig Transporte unter Segel verbilligen: Wind ist nämlich gratis.

Trocknende Bettlaken auf der «Tres Hombres». Diese ist kein fertiges Modell, aber durch Partner- und Freundschaft mit den Kunden wird vieles möglich, beispielsweise nach sechseinhalb Wochen Atlantik eine Wäsche in der Schokoladenfabrik.
Klar ist auch, dass die «Tres Hombres» kein fertiges Modell liefert. Der politisch motivierte Verzicht auf einen Motor macht Hafenmanöver umständlich. Und um die Frachtsegelbranche nachhaltig zu etablieren müssten unter anderem die Arbeitsbedingungen der Stamm-Mannschaft verbessert werden: Aktuell gebe es kein Geld, um eine Altersvorsorge für Frachtsegler einzurichten, erklärt Kapitän Wiebe. «Wir müssen segeln bis zum Tod.» Und sollte dereinst die Frachtsegelei sich in einer relevanten Grössenordnung etablieren, wird kaum ein Schwarm von Freiwilligen und Sympathisanten auftauchen, um die Schiffe zu entladen. Dann ist es vorbei mit dem festlichen Charakter einer Aktion von Idealisten, wie ich es in Amsterdam selbst unter dem Corona-Regime erlebt habe. Dann ist das einfach Arbeit, die bezahlt sein will.
Doch die Aufgabe der «Tres Hombres» ist eine politische, nämlich die Idee des Frachtsegelns zu propagieren. Dies ist gelungen, wie nun das Interesse von Firmen-Kunden wie Selecta und vor allem auch der Bau weiterer Frachtsegelschiffe zeigt, welche die Idee aufnehmen und weitertragen. Den Selecta-Investoren aus New York, deren Geschäftsmodell der Kauf und Verkauf von Firmen ist, dürften die fünf Tonnen von einer kapitalismuskritischen Crew gesegelten Kaffeebohnen ebenso egal sein wie die Umweltschäden, die ein anderes Unternehmen aus ihrem Portfolio mit der Förderung von Schiefergas anrichtet. Vermutlich wissen sie nicht einmal etwas von der Probesendung auf der «Tres Hombres». Doch in vielen Firmen dürfte es im mittleren Kader Menschen geben, welche die Prognosen des Weltklimarats, die sich abzeichnende Entwicklung hin auf katastrophale Kipp-Punkte, die schmelzenden Gletscher und die biologische Verarmung nicht ignorieren und die Sorgen ernst nehmen, denn sie sind nicht wie die oberste Geschäftsleitung direkt den kurzfristigen Aktionärs-Gewinninteressen verpflichtet. Diesen Besorgten bieten die «Tres Hombres» und zunehmend weitere Fracht-Segelschiffe eine Handlungsperspektive.
Erlebt man in der Nordsee die Prozession grosser Containerschiffe in Richtung Rotterdam – jedes mit der rund 20´000-fachen Kapazität der «Tres Hombres» –, so wird überdeutlich: Das unter Segeln transportierte Frachtvolumen bewegt sich im Vergleich zu den aktuellen maritimen Transporten im Nano-Bereich. Man mag kritisieren, dass dies rein symbolischen Charakter habe. Vermutlich geht es Geschäftsleitungen, die solche alternative Transporte wegen der höheren Kosten bewilligen müssen, nicht zuletzt ums Firmen-Image, um Greenwashing. Aber ist, wenn jemand aus möglicherweise falschen Motiven etwas Richtiges tut, das Richtige deshalb falsch? An irgend einem Punkt muss sich die Diskussion schliesslich entzünden: Dies ist die eigentliche Funktion der «Tres Hombres».

Abschied von der Karibischen See mit ihren kurzen, steilen Wellen.
Auf dem Atlantik unterwegs nach irgendwo
Der letzte Sonntag im März, der 13. Tag auf See, seit wir in Boca Chica in See unter Segel abgelegt haben. Ich erlebte den herbeigesehnten Augenblick vom Beiboot aus, sah, wie das Schiff bei leichtem Wind sich nur mit dem Marsegel langsam vom Quai löste und und in majestätischer Ruhe in die Bucht glitt, die um diese frühe Stunde noch nicht von den röhrenden Jet-Skies und Schnellbooten verpestet wurde, dann die Kurve in der engen Einfahrts-Fahrrinne meisterte und – ohne dass das Dinghi mit dem Aussenbord-Motor hätte eingreifen müssen – in die offene See stach. An der Hafenausfahrt salutierten zwei grosse Schlepper mit ihren Hörnern, Kapitän Wiebe tutete mit unserem antiken Kurbelhorn zurück: Aufbruch-Emotionen.
Nun sind wir also unterwegs nach irgendwo. Auf dem Segelplan steht Horta auf den Azoren. Doch dort wurde, wie überall in Europa, der Hafen geschlossen. Das offizielle Endziel wäre Amsterdam, wo traditionell die Fracht im Rahmen einer grossen Party entladen würde. Das Fest können wir angesichts der Corona-Massnahmen vergessen. Bleibt der eigentliche Heimathafen Den Helder, eine Tagesreise weiter – nichts Genaues weiss man nicht…
In Boca Chica haben wir die letzten Fässer Rum und über 10 Tonnen Kakao an Bord genommen. Dabei habe ich einen weiteren Schweizer Kunden von Fairtransport entdeckt, die Schmuzli GmbH im Baselbieter Hölstein, die zwei kleinere Fässer Rum unter Segeln transportieren lässt. Unser Quai war gleichzeitig Bauplatz für einen Katamaran, der künftig als schwimmende Partyplattform dienen wird: Die unförmigen alten Herren aus Europa und den USA, die sich hier von jungen einheimischen Frauen wohl nicht nur begleiten lassen, wollen sich schliesslich amüsieren. Wegen der Polyester-Baustelle wurden der Rum und die Kakao-Säcke 20 Meter weiter entladen. Die Fässer liessen sich rollen, die 70-Kilo-Säcke aber mussten wir tragen – bei tropischen Temperaturen an der prallen Sonne. Eine Sackkarre an Bord zu haben wäre in einem solchen Moment wichtiger als das Klapp-Rad, das einzig dazu diente, Getränke zu holen.

Die Rum-Fässer liessen sich rollen…
Absurde Bürokratie
Der Säcke-Berg auf dem Quai wollte und wollte einfach nicht kleiner werden, jener an Bord aber wuchs. Kapitän Wiebe trieb uns an: Falls bis 17 Uhr nicht alle Säcke an Bord seien, würden sich die Hafengebühren verdoppeln. Weshalb, das blieb offen, wie so vieles in diesem Land, wo Gesetze primär dazu dienen, Gebühren einzuziehen. Schon am ersten Tag stand gut ein halbes Dutzend Personen mit Ausweisen um den Hals, mit und ohne Uniform auf der Pier und begutachtete wortreich das Schiff – ein sichtlich aufgeblähter Beamtenapparat. Ein paar Tage später erschien eine Frau mit Ausweis am Bändel, um zu kontrollieren, ob wir den Abfall ordnungsgemäss erst nach Anmeldung beim Landwirtschaftsministerium von Bord bringen. Dass wir Verpackung entsorgen, die wir mit den Lebensmitteln hier im Land eingekauft haben, liess sie nicht gelten: Sobald etwas an Bord komme, sei es internationaler Müll. Als Gast müsse man sich an die Gesetze des Landes halten!
Das ist ja gut und recht, und dass man keine fremden Insekten und Plagen ins Land holen will, leuchtet ein. Aber diese Bürokratie wirkt absurd angesichts des Stadtteils, der an den Hafen angrenzt: Kaum je zuvor habe ich eine derart vermüllten Ort wie dieses San Andres gesehen, von den Ratten auf der Pier ganz zu schweigen. Doch sollte die Gebühr für fünf 35-Liter-Müllsäcke zuerst 1400 Euro betragen, was sich dann Per Telefon auf 1200 Euro runterhandeln liess. Der Yachthafen nahm uns den Abfall schliesslich für 100 Euro ab. So fördert der Staat in der Dominikanischen Republik die illegale Abfallentsorgung auf See, denn keine Reederei dürfte angesichts dieser Preise «gesetzestreu» handeln. Und unserem Kapitän gehen solche Bürokraten jeweils auf die Nerven, zumal oft noch Ärger mit Agenten, Zollbehörden oder Lieferterminen hinzukommt.
Zur dominikanischen Ehrenrettung sei gesagt: Mit dem normalen Volk machten wir auch gute Erfahrungen. Etwa der Fahrer des Motorrad-Taxis, der mich zu einer bestimmten Eisenwarenhandlung bringen sollte, in der ich einen Ersatz für meine Stirnlampe kaufen wollte. Der Laden war zu, er fuhr mich gratis zu einem anderen Laden. Oder der Ladenbesitzer, bei dem unsere Köchin für die verlängerte Überfahrt die zusätzlichen Wasserflaschen kaufen wollte. Wenn sie so viel benötige, werde dies bei ihm zu teuer, meinte er. Sie solle sich doch das Wasser bei seinem Lieferanten besorgen. Er organisierte ihr sogar noch das Taxi dorthin.

… aber die Kakao-Säcke mussten geschleppt werden.
Überall Kakao
Im Laderaum stauten die Stärksten die Säcke bis so dicht als möglich unters Deck. Doch der Raum reichte nicht. Nun ist der ganze Schlafbereich mit Kartons und Säcken überstellt, leere Kojen dienen als Frachtraum. Der Kakao fermentiert offenbar weiter und wir schlafen – wenn bei feuchtem Wetter der Niedergang geschlossen ist – im Dunst. Zudem haben wir in Boca Chica mit dem Kakao auch Mottenlarven an Bord bekommen. Die Viecher schwärmen nun, dagegen können wir nichts machen, Mottenfallen sind auf dem Atlantik nicht verfügbar. Ich frage mich, ob dies die Qualität des Kakaos beeinflusst. Oder sind die Motten einfach der «Preis», den man für «bio» einkalkulieren muss?
Die Fracht in den Schlafräumen zeigt, dass die «Tres Hombres» längst zu klein ist für die Nachfrage nach Segeltransport, die sie geschaffen hat. «Der nächste Schritt muss in Richtung grössere Schiffe gehen», meint Wiebe. Entsprechend ist der EcoClipper, den Fairtransport-Mitgründer Jorne Langelaan plant, deutlich grösser: Mit einer Länge über alles von 59 Metern soll das Stahlschiff 500 Tonnen Fracht aufnehmen können, mehr als das Zehnfache, was wir jetzt an Bord haben. Mit zwölf Personen Stammbesatzung, zwölf Passagieren und 36 Trainees sollen bis zu 60 Personen an Bord sein. Kleinere Schiffe wie die «Tres Hombres» könnten dann beispielsweise in Grenada die Fracht zusammenführen, der EcoClipper – vermutlich wird er «Noah» heissen – holt die Ware dann über den Atlantik. Lässt man die Trampfahrt in der Karibik – wie wir sie machten – weg, dann sind mehrere Reisen pro Saison möglich, zudem wird durch den längeren Rumpf das Schiff auch schneller.
Der Versuch, die «Tres Hombres» stärker zu nutzen und jährlich zwei Atlantik-Rundreisen zu unternehmen, hat sich dagegen vor ein paar Jahren als Fehlschlag erwiesen: Man musste auf der zweiten Reise in Boca Chica zu lange auf den Kakao warten und geriet in den Anfang der Hurrikan-Saison, die wegen der Klimaerwärmung immer früher beginnt. Es blieb nur die Flucht so schnell als möglich nach Norden. Man landete in Kanada. Schliesslich musste die erschöpfte Mannschaft ausgeflogen und für die Rückfahrt über den Atlantik durch eine andere ersetzt werden. «Wir haben da zu kapitalistisch gedacht» meint Andreas Lackner, «und wurden dafür bestraft.»
Bisher «Easy Sailing»
Angesichts zunehmend dramatischer Corona-Nachrichten aus aller Welt – gestrichene Flüge, geschlossene Grenzen und Häfen – waren wir froh, endlich ablegen zu können. Ursprünglich hätte der Aufenthalt in Boca Chica nur vier Tage dauern sollen, doch dann kam hier noch ein bisschen Extrafracht dazu, dann da eine bürokratische Hürde, dann dort eine ungünstige Windprognose. Als schliesslich die Drogenfahnder das Schiff mit ihrem Hund – dieser kam mit den steilen Treppen auf einem Segelfrachtschiff nicht klar – wieder verlassen hatten, waren wir nach zwei Wochen einhellig glücklich, den Ort mit unbekanntem Ziel verlassen zu können. Einen Corona-freieren Ort als die offene See gibt es derzeit nicht. Wo wir hinsegeln? Das müssen wir nehmen, wie es kommt…
Nachdem wir die Insel Hispaniola im Osten durch die Mona-Passage umsegelt hatten – zwischenzeitlich umkurvte uns ein Helikopter der US-Küstenwache in Puerto Rico – erreichten wir den Atlantik. Nun sind die Wellen zwar wieder hoch, aber auch lang und bisher sanft: Zunehmend wird es kälter, wir segeln vom Hochsommer in den Frühling. Zuerst die langen Hosen, dann die Socken, ein weiterer Pullover, nachts sowieso als Windschutz das Ölzeug: Tropen adieu! Die «Tres Hombres» ist aber relativ weit im Süden unterwegs, da sich im Norden ein ausgedehntes Hoch mit ungünstigen Winden breit macht. So sind wir bisher mit wenigen Ausnahmen vom Regen verschont geblieben, der in der Regel zur West-Ost-Überquerung gehört. Wirkliche Flaute hatten wir auch nicht, sondern machen gute Fahrt. Gestern hiess es, wir hätten nun den halben Weg nach Horta hinter uns. Wir werden aber wohl direkt weiter segeln. Entsprechende Wasser- und Lebensmittelreserven haben wir in Boca Chica ja noch an Bord genommen, müssen aber vor allem mit dem Wasser und dem Koch-Gas sparsam umgehen: Pro Wache gibt es nun nur noch einmal Tee und Kaffee.
Den Fender retten!
Am siebten Tag hatten wir eine nicht angekündigte Mann-über-Bord-Übung. Wiebe warf einen Fender ins Wasser und dann ging es Schlag auf Schlag. Einige Segel bergen, die anderen Segel neu einstellen, das Sicherheitsnetz an Steuerbord entfernen, damit wir das Dinghi ins Wasser lassen können. Eigentlich hätte ich da Fotos oder ein Video machen können, aber ich war – wie auch bei der Feuerwehrübung am nächsten Tag – einfach dabei, habe mitgemacht und war erstaunt, wie nahe an den treibenden Fender Wiebe das Schiff gebracht hatte: In nur rund 20 Metern Distanz fischten die beiden Leute im Dinghi den Fender aus dem Wasser.
Alles gut gelaufen. Allerdings machte der Kapitän dann bei der Besprechung eine grosse Einschränkung: Dies war eine Übung bei leichtem Wind. Bei viel Wind und hohen Wellen werde er das Dinghi nicht ausbringen lassen, denn dann habe er nicht eine Person ausserbords, sondern deren drei: Schlechte Perspektiven für die Person, die im Wasser ist – vorausgesetzt, man findet sie überhaupt. Deshalb ist das oberste Gesetz: «Don´t go over board!»
Aprilsturz statt Aprilscherz
6. April, 21. Tag auf See. Schönes Wetter den ganzen Tag, Doch während der Mitternachtswache auf den 1. April bin ich vom Dach des Galley-Aufbaus aufs Deck gestürzt. Es regnete, war Flaute und ein aufkommender Windhauch aus unerwarteter Richtung machte Segelmanöver nötig. Ich hatte am Abend zuvor gekocht, was mich wegen der Zeit, die wegen der Wachwechsel genau einzuhalten ist, in Stress versetzt hatte. Also war ich noch aufgedreht und schlief erst spät. Zudem hatte ich am Vormittag keinen Schlaf gefunden, obschon ich in der Koje lag. Jederzeit, sozusagen auf Befehl schlafen zu können, diese wichtige Eigenschaft eines Seemanns, fehlt mir. Somit war ich während dieser Mitternachtswache – auf den alten Grossseglern galt sie als «Friedhofswache» – unkonzentriert. Und vom Ruder kamen Befehle, wir sollten schneller machen, was mich jeweils nicht flinker, aber nervöser macht.
Es ging darum, das Stagsegel zwischen dem Hauptmast und dem Vormast zu setzen. Dafür sollte unter anderem eine aufgewickelte Leine vom Deck aufs Küchendach zurück. Als ich das Bündel entgegen nehmen wollte, war mein linkes Bein plötzlich im Leeren, eine Sekunde später lag ich auf dem Deck. «Kannst Du die Beine noch bewegen?» war die erste Frage, die ich wahrnahm. Ich konnte. Der Kapitän wurde geweckt, der mich dann ins Bett brachte. Insgesamt aber Glück gehabt: nur gequetschte Rippen, ein paar Tage Schmerztabletten und viel Bettruhe.
Bei idealem Wind schafft die «Tres Hombres» 220 Seemeilen in 24 Stunden, das sind rund 400 Kilometer.
Mit den Kräften haushalten
Der Unfall hat mich aus dem Rhythmus Wache-Essen-Schlafen-Wache-Schlafen… gerissen. Jedes Schiff auf See ist 24 Stunden unterwegs und muss entsprechend betreut werden. Die «Tres Hombres» fährt mit zwei Wachen, also ist man 12 Stunden pro Tag für das Schiff da. Die regelmässigen Schlafunterbrüche bringen selbst die Profis an Bord an ihre Grenzen. Hinzu kommt, dass die «Tres Hombres» keinen Raum am Trockenen hat, in dem sich wenigstens ein Teil der Wache bei Schlechtwetter aufhalten könnte. Alle sind an Deck, unter den regenprasselnden Kapuzen, das Wasser läuft kalt in die Ärmel, – auch wenn es nichts zu tun gibt. Dies entspricht einerseits der Tradition der alten Segelfrachtschiffe. Andererseits habe man sich bewusst so entschieden, da die «Tres Hombres» ein Frachtschiff und kein Charter- oder Passagierboot sei, erklärt Wiebe.
Man lässt auf längeren Törns einzelne Mitglieder einer Wache mal durchschlafen. Und bei der Atlantik-Überquerung zurück nach Europa versucht Wiebe zwar einerseits, Tiefdruckgebiete mit ihrem Wind zu nutzen, aber möglichst nicht zu nahe an deren Zentrum zu geraten: Stürme und Regen würden die Mannschaft zu schnell erschöpfen. Das ist mit einem relativ südlichen Kurs bisher gut gelungen, die Unfallnacht war eine der wenigen Ausnahmen.
Jede Wache beginnt mit der sogenannten «Seilrunde». Alle ausser dem am Ruder stehende Wachführer schwärmen aus und überprüfen die Leinen. Ist irgendwo Lose in einem Fall oder einer Brasse? Sind die Leinen auf dem richtigen Nagel belegt? Sollte man eine Schot etwas fieren oder ein bisschen dichter holen? Haben die Geitaue und Gordinge genug Lose, dass sie bei einer Veränderung der Stellung der Rahen nicht übermässig unter Spannung kommen? Diese «Seilrunde» dient nicht zuletzt dazu, sich den Ort der jeweiligen Leinen für die nächsten Stunden einzuprägen, sich auf das Schiff und die Bedingungen einzustellen. Während den nächtlichen Wachen bleibt dann oft ausser allfälligen Manövern nichts zu tun. Tagsüber beschäftigen uns dagegen – wenn das Wetter es zulässt – all die kleineren und grösseren Unterhaltsarbeiten.
Gemischte Gefühle
Nicht nur die Kräfte, auch die Ausrüstung leidet. Selbst die alte Pfadfinder-Taschenlampe – noch Glühbirnchen, kein LED – spinnt. Reissverschlüsse, Nähnadeln, Batterien – alles korrodiert. Sogar die Kleider sind, da mit Salzwasser gewaschen, dauernd klamm: Salz zieht die Luftfeuchtigkeit an.
Die Windprognosen seien gut, so dass wir womöglich bereits am 20. April in Amsterdam sein könnten, heisst es. Das wäre Rekord. Bei mir löst dies unterschiedliche Gefühle aus. Einerseits kommt man nach so einem Törn gerne wieder an Land, hofft auf eine warme Süsswasser-Dusche, gewaschene Kleider, trockene Füsse… Andererseits ginge die Reise mit der «Tres Hombres» – gebucht war bis zum 6. Mai – deutlich früher als erwartet zu Ende. Was dann weiter läuft, ist offen. Meine Wohnung ist bis Ende April untervermietet. Und in einem Amsterdam, in dem alles geschlossen ist, mein Weiterkommen oder ein Air-BnB organisieren: Fragezeichen! Mittlerweile soll es in Holland sogar verboten sein, dass zwei Personen gleichzeitig ein Auto benutzen, Züge gebe es keine… Erleichterung dagegen an der Heimatfront. Die Antwort auf meine Anfrage via Fairtransport-Büro Mail ist gekommen: Kein Corona. Alle sind gesund.
Aktuell segeln wir mit leichtem Wind nach Nordosten. An den Azoren wollten wir so nahe vorbeisegeln, dass wir das Handynetz nutzen zu können. Nun aber sparen wir uns diesen kleinen Umweg: Es geht aber vor allem darum, rechtzeitig in den Ärmelkanal zu kommen, bevor sich dort das Azorenhoch breit macht und uns Gegenwind oder – noch schlimmer – Flaute beschert. Der Verkehr im Ärmelkanal und die Tidenströmungen sind so stark, dass ein Aufkreuzen gegen den Wind mehr Stress als Fortschritt bringt. Für Motorschiffe sind die Fahrtrichtungen – man spricht von einer Seeschifffahrtsstrasse – getrennt. Da mit einem motorlosen Schiff in der Flaute auf die Gegenspur zu driften ist dagegen ausgesprochen ungemütlich.

In der Karwoche hatten wir zwischendurch guten Wind, allerdings von vorne.
Ostern
27. Tag auf See. Mystische Stimmung, zum ersten Mal Nebel über dem Wasser, in den von oben sich milchig die Sonne ergiesst. Kaum Wind, nur das leise Rauschen der Bugwelle und das Flappen der Segel, wenn ein Wellenberg der flachen Dünung unter dem Schiff hindurchläuft. Wir segeln langsam, langsam ins Nichts.
Die «Tres Hombres» hat nun in etwa auf der Breite der Bretagne erreicht, befindet sich aber immer noch weit draussen im Atlantik, näher an Neufundland als an Europa. Das bisschen Wind, das wir haben, hält sich nicht an die Wetterprognosen: Eigentlich sollte er aus Süden wehen, kommt aber aus Nord-Nordwest. Somit halten wir ein wenig weiter nach Osten, die Richtung stimmt auch so. Hier ist so unendlich viel Platz, da führen viele Kurse nach Europa.
Gestern hatten wir meistens – wie schon seit Tagen – ebenso wenig Wind. Doch von Nordwesten kam eine beeindruckende Dünung. Die Wellentäler waren gut über hundert Meter lang, die Berge entsprechend flach, aber man fühlte, dass da gewaltige Kräfte unterwegs sind. Irgendwo muss es einen Sturm gegeben haben, der solche Massen in Bewegung setzen konnte. Auch uns sollen in den kommenden Tagen starke Winde in Richtung Ärmelkanal voran bringen.
Endlich Wale in Sicht
14. April, 29. Tag auf See. Grau, grau, grau. Der Nordatlantik und der Himmel präsentieren sich wie ein ausgebleichtes Schwarz-Weiss-Foto. Kalt, die Feuchtigkeit treibt die Kälte unter die Kleider, wo sie sich mit dem Schweiss paart, der sich trotz der angeblichen atmungsaktiven Eigenschaften der Segelkelider sammelt. Die Nase tropft. Nun haben wir Ostwind, den uns ein kräftiges Hoch über Europa beschert. Dort laufen sie jetzt wohl im T-Shirt herum – wieder mal zu warm für den April. Aber wir wollen nach Osten und müssen gegen den Wind ankreuzen, da fühlt man die Kälte am intensivsten. Doch das Ausharren an Deck lohnt sich. In der Abenddämmerung zieht – endlich! – eine Gruppe Wale vorbei. In kurzer Distanz ist plötzlich ein massiger Rücken zu sehen, der auf ein Tier von sicher sechs Meter Länge schliessen lässt. Und im Lee bläst einer kurz eine Fontäne ins Grau. Hinter den Walen folgt eine Gruppe Delfine.
16. April, 31. Tag auf See. Der Wind weht Wasserstaub aus der Gischt, die das stampfende Schiff mit schäumendem Bug aufwirft. Die Wellen sind höher, der Wind steif und die «Tres Hombres» krängt kräftig nach Steuerbord. Gestern haben wir gewendet und segeln nun gegen Südosten. Jeder Meter nach Osten ist kostbar, denn da wollen wir hin. Noch sind es über 500 Seemeilen bis zum europäischen Kontinent. Das Schiff segelt wunderbar, die gut 40 Tonnen Fracht machen sich wider Erwarten positiv bemerkbar: Wir liegen tiefer im Wasser, was offenbar die die seitliche Abdrift vermindert. Und mit der Ladung als «Ballast» im Bauch kann die «Tres Hombres» mehr Segel tragen. Zwar ist das Leedeck bei jeder dritten Welle unter Wasser, aber wir machen am Wind 7 bis 8 Knoten.

Da auf einem Amwind-Kurs das Schiff ständig stark krängt, muss die Köchin den Topf mit dem fertig gekochten Reis festbinden, damit er nicht nach Lee rutscht.
Glücksgefühle am Ruder
Da am Ruder zu stehen ist ein Kick für die Glückshormone. Ich bin zwar in beiden Wachen ein bisschen ein Fremdkörper, weil ich wegen meinen Rippen immer noch nicht bei Segelmanövern an den Fallen, Brassen und Schoten ziehen kann. Aber zwischendurch mal eine halbe Stunde steuern liegt drin. Und gestern hatte ich die Ehre, die Wende zu steuern.
Segeln gelernt habe ich auf einer Jolle, da macht sich jede Ruderbewegung sofort bemerkbar. Die «Tres Hombres» ist dagegen mit ihren rund 100 Tonnen viel träger. Da kann man oft Ruder legen und es passiert vorläufig nichts. Dann beginnt der innere Dialog mit dem Schiff: «Nun komm schon, Schätzchen. Sei nicht so eigensinnig! Du bist schon 15 Grad vom Kurs ab… Na, wenn Du nicht willst, dann muss ich wohl…» Dann folgt ein weiterer Schwung am Speichenrad, das auf diesem Schiff hinter dem Rudergänger montiert ist. Und endlich will die alte Dame nun doch. «Aber nicht so schnell, Du fällst von einem Extrem ins andere!» Mit der Zeit kriegt man dann raus, wie heftig man korrigieren kann und wann man bereits Gegenruder geben muss, damit das Schiff nicht in die andere Richtung vom Kurs abkommt. Dies ist bei jedem Wind und bei jeder Segelstellung anders, man muss sich erst einmal einsteuern, bis man denn Dreh raus hat.
Das Vergnügen ermüdet aber auch. Verliert man die Konzentration, so ist es mir schon passiert, dass ich zwar korrigiert habe, noch mehr korrigiert bis ich merkte, dass ich in die falsche Richtung korrigiert habe, also das Schiff weiter vom Kurs abgebracht habe. 40 Grad daneben! Da taucht dann der Kapitän aus dem Navigationsraum auf, brüllt «Bullshit» und ähnlich poetische Ausdrücke und der Wachführer nimmt mir das Ruder weg. Dabei habe ich unbewusst doch nur das gemacht, was weltweite Praxis ist: Da wird klimaheizender Welthandel beantwortet mit noch mehr Freihandelsabkommen, Marktversagen mit noch deregulierterem Markt…
Auch körperlich geht gerade auf einem Am-Wind-Kurs das Steuern buchstäblich in die Knochen. Krängt das Boot stark nach Steuerbord, dann lastet das ganze Körpergewicht auf dem rechten Bein. Mit der rechten Hand hält man sich fest, die linke steuert. Bald einmal macht sich Müdigkeit im belasteten Bein breit, und das Hüftgelenk fängt an zu meckern. Da bin ich dann doch froh, wenn mich jemand ablöst.

Wenn die Sonne durch das Grau der Wolken bricht.
Vielschichtige Kleider
Die Gespräche drehen sich auf Wache nicht zuletzt darum, wie viele Schichten wir angezogen haben. Ich mag meine gar nicht zählen. Den Rekord hält wohl eine Schottin mit neun Schichten: Alles was sie in der Karibikhitze an T-Shirts dabei hatte, füllt nun den Raum unter der der Segeljacke aus. Sitze oder stehe ich wartend an Deck, dann schleicht sich die Kälte von den Füssen her in die Knochen. Ab und zu verzieht man sich in die Galley, wo je nach Tageszeit eine Dampfbad-Atmosphäre herrscht und das Kondenswasser von der Decke tropft. Aber immerhin ist es warm. Eine Tasse Tee, eine Scheibe Brot mit Konfitüre, und dann noch eine, um einen Vorwand zu haben, etwas länger an der Wärme zu sitzen…
Bei aller Freude am Segeln und der Aufregung, wenn Wale – selten genug – vorbeiziehen, macht sich Ermüdung breit. Dabei gehöre ich zu den Privilegierten, denn meine Koje ist bisher trocken geblieben. Andere hatten zeitweilig entweder mit leckenden Stellen im Deck zu kämpfen. Gerade die Kapitänskajüte war alles andere als dicht. Und die Köchin hat über ihrer Koje eine Art Zelt gebaut, um das Wasser abzuleiten. Oder eine Welle schickt eine Gischtwolke in den Foxhole-Niedergang, was dann mit einem nassen Bett und in der Küche zum Trocknen aufgehängten Bettlaken endet. So dominiert denn als zweites Thema der Gespräche die Frage, was wir machen werden, wenn wir nach Hause kommen. Für viele ist dies gar keine Frage: Schlafen, schlafen, schlafen.
Doch erst einmal müssen wir den Ärmelkanal erreichen und dann Amsterdam, wo uns eine völlig aus dem Ruder gelaufene Welt erwartet. Das Corona-Virus haben wir zwar nicht an Bord, es ist aber als Unsicherheitsfaktor, wie es in Amsterdam weiter gehen wird, doch ständig ein Thema.
Wir segeln auf einer Öl-Lagerfläche
19. April, 34. Tag auf See. Sonntag und in der Tat etwas Sonne. Allerdings auch stundenlang kein Wind – eine Gelegenheit, das Gaffeltopsegel herunter zu nehmen, um aufgescheuerte Nähte zu nähen. Während die «Tres Hombres» mit weniger als einem Knoten Fahrt um die Steuerfähigkeit kämpft, überholt uns extrem langsam ein Tanker. Dem Gefühl nach fährt der auch nicht mehr als zwei bis drei Konten. «Slowsteaming» nennt sich dies. Dies spart zwar Treibstoff und wird gern als Umweltschutzmassnahme angeführt. Doch der eigentliche Grund liegt in den Preisschwankungen für Öl: Man wartet auf See oder vor Anker bei Rotterdam, bis die Preise steigen. Wiebe berichtet, dass die Schiffe oft mehrere Wochen da liegen, bis sie einlaufen und ihre Ladung abgepumpt wird. Damit die Mannschaft keinen Bordkoller kriegt, darf sie zwischendurch an Land. Dies geschah bis vor ein paar Jahren mit Wassertaxis. Dann wurde die Nordsee neu aufgeteilt, und nun liegen die wartenden Tanker viel weiter draussen, unerreichbar für die Wassertaxis. Angeblich sollen die Planer enge Verbindungen zu den Helikopterunternehmen haben, die nun diesen Service bieten. Das ganze System bedeutet, dass die Ozeane nicht nur als Transportfläche für den Welthandel dienen, sondern auch als Lagerraum für Erdölprodukte. Und energieeffizienter als die Wassertaxis sind die Helikopter garantiert nicht…
Die Abgasfahne eines anderen langsamen Tankers, der gestern unseren Weg kreuzte, zeigte an, dass mit den seit Jahresbeginn geltenden etwas schärferen Emissionsregeln bezüglich Schwefelgehalt kaum etwas gewonnen ist: Dunkel zeichnete sich die Auspuff-«Fahne» vor den hellen Wolken am Horizont ab. Dass wir nun mehr Schiffen begegnen zeigt, dass wir uns Europa nähern. Von Rekord spricht allerdings schon lange niemand mehr, das Hoch über Europa hat uns mit Gegenwind und Flauten ausgebremst. Die Köchin hat schon angedeutet, dass gegen Schluss der Reise das Essen eintönig werden könnte, da die Vorräte langsam zur Neige gehen. Und hat der Kapitän bis vor ein paar Tagen jeweils auf dem Deck die Lage der zu erwartenden Hoch- und Tiefdruckgebiete aufgezeichnet und erläutert, wie wir diese nutzen können, so wünscht er mittlerweile bei den Treffen um 14 Uhr einfach noch guten Appetit: Die Wetterprognosen widersprechen sich offenbar zu stark, als dass sich daraus viel mehr als das Prinzip Hoffnung ableiten liesse – auch dies eine Erfahrung des Frachtsegelns ohne Motor: Hätten wir eine Maschine, wäre die Versuchung nun gross, diese anzuschmeissen und die letzen paar hundert Seemeilen mit fossiler Energie zu bewältigen. «Good morning!» «Is it really morning? Or ist it the same fucking day as two weeks ago?» Die Antwort zeigt, wie wir nach so ermüdender Zeit auf See das Zeitgefühl verlieren.
Zwischenhalt an der Küste der Bretagne
23. April, Bucht von Douarnenez: Um 2.20 Uhr fiel der Anker. Da die Windprognose immer noch maximal ungünstig ist, um den Ärmelkanal zu durchqueren, die Lebensmittel knapp werden und nicht zuletzt weil sich Erschöpfung breit macht, entschloss sich der Kapitän für diesen Zwischenstopp. Nun warten wir auf besseren Wind, trocknen unsere Kleider, Socken und Schlafsäcke – das Schiff ist ist zugehängt wie der Garten nach Grossmutters grosser Wäsche – und geniessen frische Lebensmittel. Diese werden von Freunden – solche hat Fairtransport offenbar überall auf den Routen, welche die «Tres Hombres» und die «Nordlys» befahren – an Land eingekauft und an der Pier abgelegt, wo unsere Leute sie mit dem Dinghi abholen können.
Dem Besuch gingen längere Verhandlungen voraus, denn auch Frankreich hat die Häfen geschlossen. Erlaubt ist nur ankern, an Land dürfen wir nicht. Das möchten wir auch nicht, denn so lange wir keinen Kontakt mit Menschen ausserhalb des Schiffs haben, gelten unsere sechs bis sieben Wochen auf See als Quarantäne-Zeit und wir können in Amsterdam das Schiff sofort verlassen. Die traditionelle Auslade-Party fällt zwar dem Corona-Virus zum Opfer. Aber wir werden hier ein bisschen feiern. Bereits eine halbe Stunde nach dem Ankern kreiste die Rum-Flasche: Erschöpfung hin, Müdigkeit her – wir hatten´s lustig bis zum Morgengrauen.
Um 16 Uhr war zum erstmals seit Wochen Land in Sicht, an Backbord war im Dunst der Leuchtturm der Île d´Oussant auszumachen. Bereits am Mittag hatten wir die schweren Ankerketten raufgeholt, woran ich mich besser nicht hätte beteiligen sollen: Der Rücken zahlte es mit verkrampften Muskeln heim, und abends bei den Manövern, um bei schwachem Wind den von den Französischen Behörden zugewiesenen Ankerplatz zu erreichen kam ich mir vor wir das fünfte Rad am Wagen. Der Sturz vom Küchendach hat mir zwar das Privileg eingebracht, nur die beiden Tages-Wachen zu bestreiten, aber nachts durchschlafen zu können. Also habe ich Kontakt mit beiden Wachen und somit mit der ganzen Crew. Aber so richtig integriert bin ich nicht mehr.
Trotzdem: Der Moment, als der Anker fiel und nach der langen Atlantikpassage eine Pause einleitete, war magisch. Und nun hängen alle stundenlang an ihren Handys und teilen den zu Hause Gebliebenen mit, dass wir Europa heil erreicht haben. Mit einer Ausnahme: Mein Fairphone hat kurz nach dem Start in Boca Chica den Geist aufgegeben, es ist nicht mehr möglich, den Akku zu laden. Feuchtigkeit oder Salzkristalle verursachen wohl irgendwo einen Kurzschluss. Offenbar ist ist die Idee, ein sozial und ökologisch weniger schädliches Smartphone zu bauen, technisch nicht ausgereift. Andere haben ihr Handy auch unterwegs offen an Deck betrieben, um Musik zu hören. Mein Handy lag dagegen immer im Regal unter Deck. Aber selbst dort hat die feuchte Salzluft zum Kollaps geführt – ein technischer Sieg für das iPhone, das ICH-Telephon mit dem egozentrischen Namen (es könnte ja auch You-Phone oder We-Phone heissen): Ein schlechtes Omen für den Mentalitäts- und Systemwandel, den wir für den Stopp der Klimaüberhitzung dringend brauchen?
Vorläufig aber verdrängt Corona diese Fragen: Europa empfing uns zuerst mit einem Kriegsschiff der Irischen Marine, das um uns herum fuhr, dann flog eine zweimotorige grosse Maschine ihre Patrouille genau um unser Schiff, später tauchte ein Helikopter auf: Angesichts der geschlossenen Häfen wird jedes Schiff, das sich nähert, argwöhnisch beäugt.

Willkommen: Frische Lebensmittel und Gas zum Kochen aus Douarnenez.
Die Unsicherheit hält an
24. April, 14 Uhr: «Take five» von Dave Brubeck und lange Songs von Fela Kuti aus dem Lautsprecher, die Sonne im Nacken, das Deck zugehängt mit feuchten Sachen zum Trocknen, die Party rollt langsam an. Heute feiern wir die Ankunft in Europa, und auch ein bisschen den Abschied, denn das ist wohl die letzte Gelegenheit, bevor wir uns in Amsterdam in alle Himmelrichtungen zerstreuen, getrieben von den strikten Corona-Vorschriften der holländischen Regierung. Vom Ufer grüsst Douarnenez, so nah und doch unerreichbar. Selbst wenn wir an Land könnten, die Restaurants und Bars mit Wifi sind geschlossen, keine Chance, Kontakte zu pflegen. Aber gestern konnte ich mit dem Handy eines weiteren Trainees zwei Anrufe in die Schweiz machen. Erleichterung: So weit sind alle gesund.
Montag, 27. April: Morgen sind es sechs Wochen, dass wir Boca Chica verliessen. Und gestern hätten wir hier eigentlich absegeln wollen. Stattdessen haben wir den ganzen Tag das Schiff auf Vordermann gebracht, damit es sich beim Einlaufen in Amsterdam schöner präsentiert. Auch heute Morgen kam der Kapitän an Deck, schaute auf die Windrichtung und kratzte sich am Kopf. So richtig passen wollen die wankelmütigen Windprognosen nicht. Zwischendurch hiess es, morgen hätten wir im Ärmelkanal 42 Knoten, was der Windstärke 9 – also einem Sturm – entspricht. Gestern war dann noch von 30 Knoten die Rede. Und heute hat sich die angekündigte Windstärke erneut reduziert. In jedem Fall wollen wir heute doch den Anker lichten und schauen, dass wir aus der Bucht herauskommen. Dies ist zumindest der aktuelle Stand…
Melancholie vor dem Abschied
Viele Erfahrungen wie beispielsweise das Wachsystem oder der fehlende Kontakt mit den Angehörigen zu Hause, gehören allgemein zur Seefahrt. Diese ist kein Abenteuerspielplatz, sondern eine Arbeit, die sich auf den ganzen Lebensrhythmus auswirkt. Diesbezüglich bin ich froh, dass ich die ganze Reise mitgemacht und somit das ganze Spektrum an Erfahrungen – Sturm ausgenommen – gemacht habe. Und bei aller Unsicherheit der Winde: Am Schluss kommt man an. Die überlange West-Ost-Überquerung des Atlantik haben wir zudem nicht nur störrischen Winden zu verdanken, sondern auch den Corona-Massnahmen. Ohne diesen hätten wir in Horta auf den Azoren eine Pause eingelegt.
Mit dem nahenden Ende der Reise frage ich mich, was das «Tres-Hombres»-Spezifische an den Erfahrungen ist. Da ist sicher einmal die Abhängigkeit vom Wind und somit der Natur, und dass diese derzeit wegen des Klimawandels weniger berechenbar ist. Solche stabilen Hochdrucklagen über Europa zu dieser Jahreszeit bereiten ja nicht nur einem motorlosen Segelschiff, sondern auch der Landwirtschaft Kopfzerbrechen. Weiter ist es die Knappheit der Mittel: Beim Nähen defekter Segel fühle ich die Sprödheit des Tuchs, da wäre Ersatz nötig. Oder eine Arbeit mit Säure wird zwei Personen zugeteilt, Handschuhe gibts aber nur für eine. Und viele Werkzeuge haben die besten Tage längst hinter sich.
Hinzu kommt der Verzicht auf Luxus. Die «Tres Hombres» ist wohl eine der nachhaltigsten Formen, das Leben unbequem zu machen. Aber sie ist – bei allem Ärger zwischendurch – wunderbar! Schon macht sich Abschiedsschmerz bemerkbar.
Auf nach Amsterdam!
30. April, der 45. Tag seit wir in Boca Chica abgelegt haben. Wir rauschen durch den Ärmelkanal. Die Frachtschiffe überholen langsam, also sind wir schnell mit Wind von achtern oder schräg von hinten. Das Grosssegel und das Royal haben wir geborgen, aber wir machen im Schnitt 8 bis 9 Knoten durchs Wasser. Haben wir die Strömung gegen uns, ist´s über Grund etwas weniger, mit dem Strom etwas mehr. Zwar gibts zwischendurch Regen – das ist der Preis für den Wind, denn ohne Fronten und Tiefdruckgebiete läuft nichts – aber auch strahlendes Wetter: pure Freude am Segeln. Nachts sahen wir erneut einen Regenbogen im Mondlicht, und dies obschon noch nicht einmal Halbmond ist. Vermutlich könnte man Mond-Regenbogen auch an Land beobachten, wäre nicht die Lichtverschmutzung so stark, dass man das Mondlicht kaum wahrnimmt.
Am Dienstag Morgen wurden wir um 5 Uhr geweckt. Der Wind war kaum wahrnehmbar, er hauchte aus Westen, der (endlich!) richtigen Richtung, um durch den Ärmelkanal zu kommen. Erst einmal stiess uns das Dinghi noch im Dunkeln aus dem Windschatten im hintersten Teil der Bucht hinaus, dann kreuzten wir unter Segel bei schwachem Wind gegen Westen. Der kalte Regen bot die letzte Gelegenheit, hier an Bord noch eine Erkältung einzufangen. Daraus wurde aber nichts: Ausser zwischendurch kältetropfender Nase hatte ich nie Probleme, das Nasenspray und Halswehtabletten blieben in der Originalverpackung. Dies war eines meiner gesündesten Halbjahre, mal abgesehen von der immer noch behindernden Rippe nach dem Sturz Galleydach. Zeitweilig war die Stimmung aber ebenso trüb wie das Wetter: Wiebe hatte uns für eine Stunde unter Deck zum Schlafen geschickt. Dann klappte es nicht mit dem Wecken, für die Wende war kaum jemand an Deck. Zudem war der Kuchen bereits vertilgt, ohne dass er und die Mates davon etwas abbekommen hätten: Standpauke, der Kapitän war sauer.
Wir brauchten rund 24 Stunden und ungezählte Wenden mit der ganzen Mannschaft, um aus der Bucht von Douarnenez mit ihren Strömungen herauszukommen und die Île d´Oussant zu umrunden. Aber dann hatten wir mit auffrischendem Westwind freie Bahn nach Nordosten. Damit war die Monotonie des Am-Wind-Segelns der letzten Wochen durchbrochen. Schon tauchte der Wachführen aus dem Navigationsraum auf und verkündete: «Wenn wir diesen Speed halten können, sind wir in 40 Stunden in Amsterdam.»
Dafür wird’s auch langsam Zeit: Auf der ganzen Reise waren ja vieles ein bisschen feucht. Aber nun in der Kälte kondensiert der Atem und der Schweiss in der Kabine und summiert sich mit der wassergeschwängerten Seeluft. Alles was irgendwie textil ist, von der mit Süsswasser gewaschenen Unterhose bis zum Schlafsack, fühlt sich ungemütlich nass an, selbst wenn meine Koje nie mit einem undichten Deck oder Gischt durch den Niedergang zu kämpfen hatte.

Die Nordsee ist buchstäblich überbaut mit Ölplattformen, Einrichtungen zum Abfackeln von Gasen, Windparks und Ankerplätzen für Tanker und Containerschiffe vor dem Hafen Rotterdam.
Kanalfieber
In Douarnenez hatte uns ein grosser Delfin empfangen, der bei der Ankunft mit unserem Dinghi flirtete. Gleich machten die Spekulationen die Runde, er habe sich in das Beiboot verliebt, oder er werde sonst von Fischkuttern gefüttert und komme deshalb so nahe. Während wir vor Anker lagen, war er verschwunden. Doch als wir aufbrachen war er wieder da und begleitet uns seither. Weshalb er den Narren an unserem Schiff gefressen hat, sagt er uns nicht. Aber wir gehen zwischendurch schlafen, wechseln uns mit den Wachen ab. Er muss dagegen die ganze Zeit schwimmen – eine beachtliche
Leistung!
Mittlerweile sortiere ich meine sieben (es sind deutlich mehr) Sachen: Was nehme ich mit zurück, was verschenke ich, was kann man auf dem Schiff weiter verwenden, was schmeiss ich weg? Wiebe bezeichnet dies als das «Kanalfieber». Auch auf den früheren Frachtseglern haben die Matrosen im Ärmelkanal angefangen zu packen. Die Gedanken kreisen um die Zukunft an Land.
Ankunft in Holland
3. Mai, Industriehafen Amsterdam: Vorgestern Abend legten wir in Ijnmuiden, dem Eingang zum Kanal nach Amsterdam an. Mit dem Schlepp-Boot kam Andreas an Bord, um von Wiebe das Kommando zu übernehmen. Er brachte nicht nur Bier, sondern auch Essen mit, das Whoopie, die gute Seele aus dem Mannschaftshaus in Den Helder, gekocht hatte: wieder dieses Fairtransport-Familiengefühl. Und auf dem Quai warteten mehrere, die eine oder mehrere Etappen mitgesegelt waren und es trotz der Corona-Einschränkungen hierher geschafft hatten: Umarmungen, Emotionen… Gestern dann die Schleppfahrt hierher an den Quai der Chocolate Makers, wo wir am Dienstag den Kakao entladen werden. Normalerweise ist dies ein Anlass mit rund hundert Personen, wegen Corona wird diese Party entfallen. Aber die mit Fairtransport befreundeten Chocolatiers, Kunden seit den ersten Stunden, haben für uns einen WC- und Duschwagen gemietet: Die erste warme Dusche seit Santa Cruz de la Palma – nach der Atlantikkälte ein Hochgenuss!
Die Fahrt durch den Ärmelkanal und vor allem die Nordsee machte deutlich, was unsere Bequemlichkeit an Land auf dem Meer anrichtet: Die Abgase überholender Tanker waren deutlich zu riechen. Je mehr wir uns der Küste näherten, desto mehr Infrastruktur tauchte auf: Schwarzgelbe Bojen, die Unterwasser-Einrichtungen anzeigen, oder unförmige Gestelle auf Stelzen, die vermutlich der Entlüftung von Pipelines oder dem Abfackeln von Gasen dienen. Dann eine Ölbohrplattform, allein schon optisch ein Fremdkörper. Davon gibt es weiter nördlich rund 750 Stück. Jährlich lassen sie im Normalbetrieb 8000 Tonnen Öl und 220´000 Tonnen Chemikalien ins Meer. Hinzu kommen die kleineren und grösseren Unfälle. Da es zunehmend schwieriger wird, das Öl zu fördern, nimmt die Umweltbelastung dauernd zu. Die Plattformen sind in die See gebaute Fabriken, die massenhaft CO2, Stickstoffoxide, Schwefeldioxid und nicht zuletzt Methan ausstossen.
Auch die Windparks lösen gemischte Gefühle aus: Dienen sie dazu, Atom- und Kohlekraftwerke zu ersetzen, sind sie willkommen. Doch wenn es nur darum geht, der täglichen Energieverschwendung ein grünes Mäntelchen umzuhängen und die Illusion zu erwecken, wir könnten mit ein paar technologischen Kniffs so weitermachen wie bisher, sind sie fragwürdig. Auf der Nordsee nehmen sie zunehmend Platz in Anspruch, der dann einem Frachtsegelschiff wie der «Tres Hombres» fehlt. Es stresst die Mannschaft, mit einem aus ökologischen Gründen motorlosen Schiff, das sich nur relativ umständlich manövrieren lässt, auf den offiziellen Fahrwasser der Seeschifffahrtsstrassen zwischen all den grossen Frachtern und Fähren segeln zu müssen. Und wenn hinter einem Windpark die Ankerzone für die Tankschiffe liegt – auf Anhieb waren gegen zwanzig Schiffe auszumachen, aber im Dunst werden es mehr gewesen sein – dann wird deutlich: Dies ist kein Meer mehr, das ist eine erweiterte Zivilisationszone, die wir an Land kaum wahrnehmen – der ideale Ort, Schattenseiten der Profitwirtschaft zu verstecken.
Zurück in der Zivilisation
Hier im Hafen holt mich die schöne neue Welt ein. Vorbei die Zeit, als ich Bord zwar meine Autonomie aufgegeben hatte, nicht bestimmen konnte, was ich wann esse, dem Wach-Rhythmus und Kommandos unterworfen war, aber auch selbst nur wenige Entscheidungen treffen musste. Nun studiere ich lang und breit Internet-Fahrpläne, um trotz Corona den besten Weg nach Basel zu finden.
Die Kontaktaufnahme wegen des kaputten Handys zur Fairphone-Zentrale hier in Amsterdam scheiterte, weil sie die Rechnungsnummer wissen wollen, sonst lässt sich die Anfrage nicht abschicken. Die erwarten wohl, dass man als Kunde selbstverständlich die ganzen Rechnungen mit auf den Atlantik, am besten auch auf den Mount Evers und an den Südpol mitnimmt… Dafür dürfte ich dann mit fünf Stufen beurteilen, ob der Internet-Artikel hilfreich war. Lohnt es sich wirklich, für eine solche zivilisatorische Kompliziertheit – notabene sogar in einem Alternativprojekt – die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten an die Wand zu fahren? Da lernt man die direkte Gradlinigkeit an Bord eines Frachtsegelschiffs nachträglich nochmals schätzen. Liesse sich dies auch auf das Leben an Land übertragen?

Laden in der Dunkelheit: Wir mussten teilweise bis zum Abend warten, um die 70 Kilo schweren Kakao- und Kaffeesäcke zu übernehmen.
Die Don Quijotes des 21. Jahrhunderts
Frühes Wecken, um halb sieben kommt der Schlepper, der uns von der Marina in den Handelshafen hinüber bringt. Der Kontrast zwischen dem Yachthafen einerseits, wo die Reichen sich sinnigerweise per Fingerabdruck – sonst gehört dies zur Behandlung von Kriminellen – ausweisen und der Besitzer einer benachbarten Motoryacht sich inklusive weiblicher Begleitung per Helikopter einfliegen liess, und dem Industriehafen andererseits, könnte kaum grösser sein: Lärm und nochmals Lärm, Staub, Asphalthitze. Kurz darauf legt sich die «Gallant» neben uns an den Quai. Dann beginnt das Warten, warten in unbarmherziger Sonne. In wenigen Metern Distanz be- und entlädt ein gigantischer Portalkran Containerschiffe. 65 Meter ragt der Ausleger über das Hafenbecken, insgesamt 100 Meter weit schweben die Container im Minutentakt durch die Luft.
Warten. Unsere frühe Tagwacht wird nicht belohnt. Endlich fährt ein Lieferwagen vor, die Plombe wird mit einer grossen Zange geknackt, darin findet sich eine einsame Palette mit dem Zucker für Pronatec. Ein Polizist stösst einen dicken Metalldraht in die Säcke und riecht daran, wenn er ihn wieder herauszieht. Zwischendurch nimmt er den Helm ab, wischt sich den Schweiss von der Stirn, findet kein Kokain.
Der Zucker wäre nun da, doch Wiebe will ihn nicht an Bord nehmen, solange die Papiere dazu fehlen. Als warten wir auf die Papiere – wohl eine weitere Nachlässsigkeit des Agenten. Der Fahrer des Lieferwagens setzt sich im spärlichen Schatten seines Gefährts auf den Asphalt und isst sein Sandwich. Die Stunden verrinnen. Da wir nach dem Laden direkt auslaufen müssen, schickt uns Wiebe für eine Stunde Schlaf in die Kojen. Am Nachmittag setzt ein Ungetüm mit lautem Dröhnen endlich einen 20-Fuss-Container neben uns auf die Pier, bis oben voll mit Kartons, Kaffee- und Kakaosäcken. Den Zucker konnten wir mittlerweile doch noch im Laderaum verstauen. Arbeiter des Kakaolieferanten werfen die Säcke auf Paletten, die sich zunehmend auf dem Quai aufreihen. Wie wir das alles unterbringen sollen, ist mir ein Rätsel, denn unser Laderaum ist bereits zur Hälfte voll mit Rum, und sein Volumen entspricht dem des vollen Containers. Doch da gibt es ja noch die «Gallant», die mehr als die Hälfte an Bord nimmt.

Die Säcke werden über eine festgelaschte Leiter aufs Schiff geschoben.
Der Schweiss rinnt
Endlich können wir laden. Auf der Leiter, unter die wir die Sicherheitsnetze montiert haben, werden die Säcke an Bord geschoben und im Laderaum von starken Armen in Empfang genommen. Das lauwarme Wasser aus unserem Bordtank macht in leeren Rum-Flaschen die Runde und rinnt durch trockene Kehlen. Die Nacht bricht herein. Viele Kaffeesäcke lecken. Sie müssen, damit die grünen Bohnen nicht herausrieseln, genäht werden, bevor sie im Laderaum verschwinden. Endlich ist der letzte Sack geschafft. Essen, und dann ab in die Kojen. Wiebe hat bei den Behörden durchgedrückt, dass wir nicht sofort auslaufen müssen. Die Erschöpfung ist die beste Schlaftablette gegen den Motorenlärm der Containerlifte auf dem Quai und dem ohrenbetäubenden Piep-piep-piep-Alarm, wenn sie rückwärts fahren. Und einer setzt immer zurück.
Während wir uns mit dem Inhalt eines einzigen 20-Fuss-Containers abmühten, hat der grosse Kran vier Containerschiffe abgefertigt, voll mit 40-Fuss-Containern. Die Lastwagen fahren in Kolonne vor, um die Bananencontainer von Dole abzuladen. Gegen diese Geschwindigkeit des Umschlags wirken wir aus der Zeit gefallen, wie seefahrende Don Quijotes des 21. Jahrhunderts. Doch so wie es auf dem Quai und am gegenüberliegenden Massengut-Pier zugeht – da werden die riesigen Lastwagen gleich als Ganzes gekippt – werden die Lebensgrundlagen unseres Planet zerstört. Dagegen segeln wir an.

Das Stauen im Laderaum ist Knochenarbeit.
Auf dem nautisch härtesten Abschnitt der Reise
Am nächsten Morgen legen wir – nicht ganz ausgeschlafen – ab. Der Schlepper bringt uns in sichere Distanz zum Ufer. Segel setzen, wir sind auf dem Rückweg nach Europa. Den Passat, der uns so locker über den Atlantik geschoben hat, haben wir nun gegen uns. Direkt nach Boca Chica in der Dominikanischen Republik segeln können wir nicht, sondern müssen gegen den Wind und die Wellen kreuzen. Die klassische «Tres-Hombres»-Route führt in einem langen Schlag nach Norden, wo man dann je nach Windrichtung eher in Jamaika als bei der Insel Hispaniola landet, die sich Haiti im Westen und die Dominikanische Republik im Osten teilen. Auf Jamaika haben wir jedoch entgegen dem ursprünglichen Segelplan nichts verloren, es gibt keine Fracht. Also versucht unser Kapitän eine neue Route, indem er die Tag-Nacht-Winddrehungen vor der kolumbianischen Küste ausnutzt, um schon hier möglichst weit nach Osten zu kommen. Die Rechnung geht auf. Wir erreichen – immer so hoch wie möglich am Wind segelnd – Hispaniola auf der Staatsgrenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik.
Noch 70 Seemeilen bis Boca Chica. Doch nun haben wir zusätzlich eine Strömung von mehr als zwei Knoten gegen uns. Traditionelle Frachtschiffe können auf dem Am-Wind-Kurs nicht so viel «Höhe» – so nennt man die effektiv gegen den Wind erreichte Strecke – machen wie eine moderne Yacht. Deshalb benötigen wir für eine Strecke, die wir sonst bei gleich starkem Wind in einem halben Tag absegeln würden, fünf Tage.
Das Wenden eines Rahsegel-Schiffs will geübt sein
Das dauernde Anbolzen gegen die Wellen ermüdet den Körper, und wer im «Foxhole» im Vorschiff schläft, kommt weniger zur Ruhe als bei einem Raumschot- oder Vorwindkurs. Zudem sind die Wellen kurz wie auf einem Binnensee. Wer von der Crew schon mal den Atlantik überquert hat, schwärmt von dessen langen Wellen. Aber für uns führt kein anderer Weg aus der Karibik heraus als weiter hin und her schräg gegen den Wind zu segeln und immer wieder zu wenden.
Dieses Manöver, bei dem der Bug durch den Wind geht und die Segel die Seite wechseln, funktioniert zuerst mehr schlecht als recht. Doch schliesslich beherrschen wir das Spiel mit den vielen Leinen. Trotzdem: Ein Schiff wie die «Tres Hombres» zu wenden nimmt gegen eine halbe Stunde in Anspruch: Zuerst müssen wir einige Segel bergen, dann die vielen Leinen vorbereiten und unsere Stationen beziehen. Dann folgt die eigentliche Wende, die in rund fünf Minuten über die Bühne geht. Anschliessend setzen wir die vorher geborgenen Segel wieder, dann folgt der Feintrimm. Schliesslich müssen wir alle auf dem Deck wie Spagetti herumliegenden Leinen aufräumen. Erst dann ist die Wende geschafft.
Vor Boca Chica kreuzen wir dann eine weitere Nacht auf See, da wir die schwierige Einfahrt durch die enge Fahrrinne nur mit dem sanften Nachmittagswind wagen können. Für alle Fälle müssen sowohl am Bug als auch am Heck die Anker als allfällige Notbremse bereit liegen. Die Ankerkette aus ihrem Lager tief unter der Küche hochzuholen ist jeweils ein schweres Stück Arbeit – der Preis, den wir für das Segeln ohne Motor zu entrichten haben. Die Einfahrt in den Hafen gelingt dann aber perfekt. Sobald wir wir wieder auf See sind, werden wir die Kette wieder verstauen.

Der Drogenfahnder stochert in den Zuckersäcken vergeblich nach Kokain.
Nur fast wie vor 100 Jahren
Neben den Manövern und sonstigem Bedienen der Segel fallen eine Reihe weiterer Arbeiten an. Der Morgen beginnt mit dem Auspumpen der Bilge, dem tiefsten Raum des Schiffs. Dabei wird gezählt, wie viele Wasserstösse aus welcher Abteilung des Schiffs die antike Pumpe zu Tage fördert. Dies wird ins Logbuch eingetragen, zur Kontrolle, wo das Schiff leckt: Praktisch jedes Holzschiff macht Wasser. Die «Tres Hombres» war zu Beginn der Reise dichter als jetzt. Die Belastung durch die Bewegung und die Wellen öffnet nach und nach Ritzen zwischen den Planken.
Anschliessend waschen wir das Deck. Dies soll nicht zuletzt verhindern, dass die Decksplanken aus einfachem Nadelholz – Teak ist für Yachten – nicht austrocknen und das Deck deshalb undicht würde. Also fassen wir mit Eimern Seewasser an der Pumpe und überschwemmen damit das Deck, während andere mit Bürsten das Holz schrubben.
Hinzu kommen all die Unterhaltsarbeiten, eta indem wir auf See die Holzteile schleifen und mit Leinöl einstreichen. Dies führte auf dem Weg nach Boca Chica zu einer Diskussion: Wir seien zu viel am Arbeiten und kämen zu wenig dazu, das Segeln zu geniessen, reklamierte ein Trainee. Damit kam er bei der Stamm-Crew schlecht an: Die «Tres Hombres» sei ein Fracht- und kein Passagierschiff. Zudem werde die Tradition gepflegt: Nirgendwo sonst sei derart hautnah erfahrbar, wie es vor hundert Jahren auf den damaligen Frachtsegelschiffen zuging.
Dies stimmt nur zum Teil: In unserer Bordbibliothek fand ich ein Buch, das der zweite Maat eines britischen Frachtseglers über die Reise eines Schiffs mit Kohle und Guano um 1909 schrieb. Zwar kommen da der «Deckswasch» und die kontinuierlichen Unterhaltsarbeiten auf See auch vor. Aber selbst wenn wir auf der «Tres Hombres» sehr einfach leben: So hart wie damals ist es dann doch nicht. Vor allem haben wir uns das Abenteuer selbst ausgesucht, während damals bei Mannschaftsmangel man teilweise einfach Besoffene an Bord geschleppt hat, die dann auf See wieder zu sich kamen und – selbst ohne die geringste seemännische Ausbildung – an Bord arbeiten mussten. Dies nannte man «schanghaien». Andere liessen sich im letzten Moment anheuern, um beispielsweise Problemen mit der Polizei zu entkommen. Den Kapitänen waren diese Motive bekannt, aber sie hatten lieber zwielichtige Gestalten an Bord als zu wenig Mannschaft. Die Disziplin wurde dann teilweise mit physischer Gewalt erzwungen. Andererseits war allen klar, dass das Schicksal des Schiffs – und damit das eigene – von der Zusammenarbeit im Rigg und an den Schoten und Brassen abhing. Viele desertierten dann bei der erstbesten Gelegenheit, selbst wenn sie dadurch auf den Lohn, der ihnen zustand, verzichteten. Um nicht einen Teil der Mannschaft so zu verlieren, wurde ihnen der Landgang oft verwehrt, wenn sie vor Anker lagen und sie bei Gluthitze Ballast, Kohle oder Guano schaufeln mussten.

Der Kakao für Zürich kommt noch bei Tageslicht an Bord.
Voll beladen zurück nach Europa
Hier in Boca Chica machen wir uns nun bereit für den Atlantik. Viele Leinen im Rigg sind mittlerweile abgenutzt und müssen überprüft und allenfalls ersetzt werden. Mehrere Laschings, mit denen die Segel an den Rahen angeschlagen sind, müssen wir erneuern. Beim Zusammenfalten des Gaffel-Topsegels haben wir eine weitere offene Naht entdeckt, und viele Stage und Wanten müssen wir nachspannen. Boca Chica selbst wirkt wenig einladend. Bekannt als Strandparty- und Sexdestination empfing uns der Ort schon auf See mit mehr Abfall als ich sonst irgendwo auf der ganzen Reise gesehen habe: Fastfoodgeschirr, Petflaschen, Plastiktüten… Aber um den Blog-Beitrag hochladen zu können, werde ich doch irgendwo einen Geldautomaten und dann eine Bar mit Wifi suchen müssen.
Der Grund, dass wir ausgerechnet hier anlegen, liegt in der Geschichte der Tres Hombres. Auf ihrer ersten Fahrt brachte sie nach dem damaligen Erdbeben Hilfsgüter nach Haiti. Auf dem Rückweg brach dann am Vormast die oberste Stenge, die das Royalsegel trägt. Für die Reparatur ging man hier an Land und entdeckte dabei eine Rumfabrik, die seither zu den Fairtransport-Lieferanten zählt. Hier werden also die letzten leeren Fässer gefüllt, die wir in Dieppe an Bord genommen haben. Zudem kommen zehn weitere Tonnen Kakao an Bord.

Nach der anstrengenden Nacht auf See vor Santa Marta muss das Bramsegel genäht werden.
Nicht alles läuft rund
Die Reise von Grenada nach Santa Marta war ein Rennen gegen die Zeit: Wir sollten unbedingt noch bei Tageslicht von einem Schleppschiff in Empfang genommen werden. Insgeheim war es auch ein Rennen gegen die «Gallant», die 40 Seemeilen hinter uns auf dem GPS-Bildschirm erschien. In der ersten Nacht nach unserem Aufbruch mussten wir sogar das Grosssegel reffen, was die meisten von uns noch nie gemacht hatten – Stress! Dann folgten lange Phasen, in denen das Schiff 8 bis 9 Knoten machte und bis auf das Rauschen der Bugwelle Ruhe herrschte.
Doch dann fiel kurz vor dem Ziel der Wind zusammen, wir konnten die geplanten 8 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit nicht halten und kamen erst nach Einbruch der Dunkelheit an. Die Stadt empfing uns von weitem mit einer beleuchteten Hochhaus-Skyline und in der Bucht den Ankerlichtern grosser Schiffe. Der Schlepper nahm die «Tres Hombres» auf den Haken. Doch bei hartem Wind – er hatte im ungünstigsten Moment wieder aufgefrischt – und kurz-bockigem Seegang brach die Schleppleine. Wir müssen diese jeweils ganz unten am Bug durch eine Schäkel führen, damit die Trosse nicht mit dem Bugspriet in Konflikt kommt und da etwas beschädigt. Dann geriete nämlich das ganze Rigg ausser Kontrolle: Der Vormast mit den Rahsegeln ist gegen vorne mit Drahtseilen, die zum Bugspriet führen, abgestützt. Aber der harte Knick im Schäkel ist für jede Leine ein Problem. Als dann auch die als Ersatz übergebene zweite Schleppleine brach und wir bereits in bedenkliche Nähe zu den verankerten Grossschiffe abgetrieben waren, hiess es Segel setzen, um das Schiff wieder aus eigener Kraft manövrierfähig zu machen. Gegen den Wind in den Hafen zu segeln lag nicht drin, also nahmen wir – Plan B – Kurs auf die offene See.
Mit nur wenig Segeln – der Wind wehte mit kräftigen 7 Beaufort – kreuzten wir die ganze Nacht vor Santa Marta und trieben dabei immer weiter nach Süden ab. Die Mannschaft wurde in drei Wachen eingeteilt, die je zwei Stunden an Deck die Segel bedienten. Kurz vor der Dämmerung flaute der Wind deutlich ab und wir setzten mehr Segel, um zurück nach Santa Marta zu kreuzen. Weit vor dem Hafen nahm uns der Schlepper in Empfang. Die Schlepptrosse brach in den Wellen drei weitere Male. Ob wir den Hafen überhaupt je erreichen würden, wurde zum Krimi…
Bei diesem Seegang kommt die Leine immer wieder ruckartig unter Zug, was sie dann nicht lange aushält.
Was sich die Leute auf dem Schleppboot dachten, weiss ich nicht. Aber sie werden sich gefreut haben, denn die Zeit lief zu ihren Gunsten: Das Abenteuer dürfte Fairtransport recht teuer zu stehen kommen. Als wir den Hafen – viel später als gedacht – doch endlich erreichten, lag mitten in der Bucht die «Gallant» vor Anker. Sie hat einen Motor, was der Crew die Sicherheit und das Selbstvertrauen gibt, auch bei starkem Wind ein Hafenmanöver aus eigenen Kraft zu fahren. In dieser Nacht hat die Gallant wohl deutlich weniger Diesel verbraucht als unser Schleppboot. Der politische Entscheid, auf einen Motor ganz zu verzichten, führt also in der Praxis nicht immer zu weniger Emissionen, aber zu deutlich höherem Stress für Mannschaft und Kapitän. «Dies war meine bisher schlimmste Segelerfahrung», erklärte dieser am nächsten Morgen.
Das Reissen an den Brassen und Schoten hat Folgen. Wir liegen hier vorläufig im Yachthafen. Die ganz dicken Boote wie in Grenada gibts hier nicht, aber man hält das gemeine Volk aus diesem Ghetto der Wohlhabenden fern, indem die Kunden der Marina einen Fingerabdruck abliefern und dieser dann Zugang zum Hafen, zu den Duschen etc. ermöglichen soll. Also standen wir alle im Büro und versuchten einen Finger nach dem anderen. Zwecklos: Die rauen Leinen an Bord hatten in dieser verrückten Nacht unsere Haut-Rillen weggeschmirgelt.
Eine weitere Frachtsegel-Kundin aus der Schweiz
Im Hafen gibt es bei Ankunft immer viel zu tun, und das erst recht nach so einer Nacht. Es ist ja schön, dass unser Schiff Aufmerksamkeit erweckt und die Leute massenhaft das Handy zücken, um uns abzulichten. Das Schiff soll schliesslich eine positive Botschaft vermitteln. Aber wenn man dreckig, zwischen Erschöpfung und erhöhtem Adrenalinpegel schwankend, in der prallen Karibiksonne versucht, an Deck Ordnung zu schaffen, dann können einen die frisch geduscht auftauchenden Leute aus dem Yachthafen mit ihren eleganten Sonnenbrillen und ihrer Neugier deutlich nerven.
Doch diesmal war (wow!) eine Frachtsegel-Kundin aus Zürich dabei. Laura Schälchli als Geschäftsleiterin der kleinen Schokoladenmanufaktur La Flor besucht hier ihre Kakaolieferanten und hat extra einen Abstecher nach Santa Marta gemacht, um das Schiff zu sehen, mit dem sie erstmals ihren Kakao unter Segeln transportieren lässt. «Unser Ziel ist es, das extrem industrialisierte Produkt Schokolade für die Kunden transparent zu machen», erklärt Schälchli. La Flor verarbeite den Kakao kleiner Produzenten, die teilweise alte Sorten suchen und anbauen, um so zum Erhalt der Biodiversität beizutragen. «Wir hatten den emissionsfreien Transport seit unserer Gründung vor fünf Jahren auf der Liste. Ich bin gespannt, wie das nun klappen wird.»
Schwachpunkt Agenten
Dass für jene, die sich als Erste auf das Experiment Segeltransport einlassen dies erheblichen Mehraufwand bedeutet, zeigt sich für Pronatec: Da sich unser Schiff angeblich verspätet hat und Pronatec respektive der Spediteur dies nicht rechtzeitig erfahren haben, lagert der Zucker nun hier zu hohen Tagesgebühren im Hafen bei 40 Grad Karibikhitze.
Dabei ist offenbar in vielen Häfen der lokale Zollagent ein Schwachpunkt. Unser Kapitän telefoniert oft stundenlang, bis er die nötigen Informationen bekommt. Auf Grenada war es so, dass der Agent gar nicht im Land war und Wiebe erst eine andere Agentur suchen musste. Dabei ist die jeweilige Agentur nicht zuletzt dafür zuständig, uns einen Platz im Hafen zu organisieren, sowohl für die Liegezeit als auch für das Laden der Fracht.
Hinzu kommt, dass wir zwar ein Frachtschiff sind. Aber wenn wir als solches in gewisse Häfen einlaufen, fallen übermässig hohe Gebühren an, da diese für grosse Schiffe bemessen sind. Deklarieren wir uns dagegen als Yacht, dann ist der Im- oder Export von Ware verboten. Offenbar nehmen angesichts dieser Schwierigkeiten viele professionelle Verzollungsagenturen die «Tres Hombres» nicht wirklich ernst: Viele Ausnahmen und Verhandlungen mit der Bürokratie für ein winziges Frachtvolumen… Hinzu kommt, dass wir jenes Welthandels-System aktiv in Frage stellen, von dem sie leben und von dem sie ein Teil sind. Das fördert natürlich ihr Engagement kaum.
Über die Verspätung ist man dagegen bei La Flor froh: Derzeit gibt es in Kolumbien politisch motivierte Strassensperren, und es sah zuerst so aus, als ob deswegen ihr Kakao nicht rechtzeitig eintreffen würde. Nun ist er aber da: Wir werden also unter anderem neben dem Zucker für Pronatec 1,2 Tonnen Kakao für «La Flor» laden. Mit all dem Kaffee und Kakao für andere Kunden werden wir den Hafen über 16 Tonnen schwerer verlassen. Zudem wird die Gallant 22 Tonnen Kaffee laden, zudem Kakao und Zucker, bevor sie für weitere Fracht in Richtung Mexiko in See sticht. «Eine Bewegung für emissionsfreien Transport unter Segeln entsteht, und unsere Firma will von Anfang an Teil dieser Bewegung sein», betont Laura Schälchli. Ähnlich sieht man dies bei Pronatec, wo sich aber angesichts der unnötigen Zusatzkosten auch eine gewisse Ernüchterung zeigt.
Trotzdem: Die Bewegung wächst. So sind hier zwei Trainees an Bord gekommen, die zuvor am Neubau des Segelfrachtschiffs «Ceiba» in Costa Rica mitgearbeitet haben. Und zwei von uns verlassen hier die «Tres Hombres», um an der «Ceiba» mitzubauen.

Reparieren, reparieren, reparieren. Aber irgendwann hat die Kaffeemühle dann ihren Dienst doch eingestellt und musste ersetzt werden.
Kein Zuckerschlecken
Wir Trainees unterstützen mit Geld – wir bezahlen ja für unseren Aufenthalt an Bord – und Arbeit die Idee. Dabei gilt die Tres Hombres als etwas vom Härtesten, was derzeit unter Segeln unterwegs ist: Auf anderen Traditionsschiffen gibts Süsswasser für die Körperpflege, die Kabinen bieten mehr Luft, es gibt Aufenthaltsräume unter Deck, in denen alle Platz haben. Auf der Tres Hombres schläft die Mehrheit im «Foxhole» – im «Fuchsbau» – im Vorschiff in einer Atmosphäre, die etwa dem Massenlager-Mief einer SAC-Hütte enspricht. Ich habe mal eine Nacht testweise im Foxhole verbracht. Ergebnis: Trotz dem offeneren Raum ist die Luft auch nicht besser als in den sogenannten Kabinen mittschiffs und achtern. In Martinique hat eine Trainee ds Schiff aus diesem Grund nach einer Nacht wieder verlassen. Wer bleibt nimmt zu einem Drittel für das Abenteuer und zu zwei Dritteln für die hinter der «Tres Hombres» steckenden Vision diese Bedingungen und die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten in Kauf.
Auf See bestimmen die Wachen den Tagesablauf: Beispielsweise von 8 bis 14 Uhr unsere Steuerbordwache, dann sind bis 20 Uhr die anderen von der Backbordwache dran. Bis Mitternacht dann wieder wir, bevor wir bis 4 Uhr frei haben und dann den Kreis der Wachen bis um 8 Uhr fertig machen. Die nächsten 24 Stunden ist es dann genau umgekehrt. Man hat also jede zweite Nacht zwei Wachen. Die Herausforderung dabei ist, möglichst jede Freiwache in der Koje zu verschlafen, auch wenn draussen schönstes Segelwetter ist. Sonst fängt man schnell ein saftiges Schlafmanko ein, das einem die Freude am Segeln arg verderben kann und die grosse Forderung nach Alternativen zum heutigen Welthandel aus dem Blickfeld geraten.
Essen gibts um 8, 14 und 20 Uhr. Dabei ist jeweils zuerst die an-, dann die abtretende Wache dran. Die Galley – also die Küche – ist zu klein für die ganze Mannschaft. JedeR wäscht in der Regel sein Geschirr und Besteck selbst, trocknet es ab und versorgt es wieder. Die Leute von der antretenden Wache waschen dann – teilweise nachts ohne Licht sich breitbeinig gegen die Beegungen des Schiffs abstützend – das Kochgeschirr, die Pfannen, die Kuchenbleche und was sonst noch anfällt. Im Navigationsraum hängt die Schiffsordnung, wonach man den Abwasch theoretisch mit warmem Seewasser und das Nachspülen mit Süsswasser erfolgt. In der Praxis müssen wir sowohl mit dem Gas als auch dem Süsswasser sparsam umgehen, also waschen und spülen wir mit kaltem Meerwasser. Das Öko-Spülmittel entfernt aber mit kaltem Salzwasser das Fett nicht wirklich, und die Köchin spart nicht mit Olivenöl. Deshalb sind auch die Abtrocknungstücher kurzum schmuddelig und saugen das Wasser nicht mehr auf, zumal sie ja auch voll Salz sind und dieses die Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Das Geschirr und Besteck wird somit halb feucht und fettig eingeräumt. Bei den Tassen schmeckt der erste Schluck oft salzig. Nach den gängigen Hygieneregeln müssten wir alle krank dahinsiechen, zumal wir sehr eng aufeinander leben. Aber wir sind munter (wenn wir nicht gerade schlaftrunken zur Wache erscheinen).

Wir essen natürlich nicht nur Haferbrei und Kürbis. Aber wenn es dann ausnahmsweise mal Pizza gibt, ist dies ein richtiges Fest.
Der Grund dafür ist wohl, dass wir sehr gesund essen. Fleisch gibts selten, Fisch nur, wenn wir welchen gefangen haben. Aber auf den kurzen Strecken in der Karibik haben wir bisher die Schleppangel nicht über Bord gehängt. Der Stockfisch, den wir in Spanien an Bord genommen haben, ergab zwei Mahlzeiten. Den Rest hat der Kapitän unter Protest der portugiesischen Köchin denn weggeschmissen – wegen des Gestanks. Es gibt keinen Kühlschrank an Bord (Energie sparen…), und so roch auch der aus unerfindlichen Gründen aufgetauchte Fonduekäse bald einmal etwas intensiver. Ich habe ihn bis zum Schluss verteidigt, musste ihn aber möglichst weit weg von allen anderen auf offenem Deck essen. Ein belgischer Trainee machte ein Lied, das meine angebliche Stärke besang, da ich Käse esse, der alle anderen umbringen würde. Unsinn! Der Geruch erreichte nicht einmal Schabziger- oder Limburger-Intensität…
Wo der Kürbis König ist
Die fehlende Möglichkeit, Lebensmittel zu kühlen, wirkt sich auf den Speiseplan aus: Wurden in der Nordsee die kalten Füsse mit Joghurt, Butter und Käse kompensiert, so wurde die Butter immer weicher, je weiter wir nach Süden kamen, und schliesslich verschwand sie ganz, machte Erdnussbutter und Sesampaste Platz. Auch das Gemüse leidet unter der Hitze. Nach dieser Reise werde ich entweder fünf Jahre einen weiten Bogen um Kürbis machen oder mich aus lauter «Tres-Hombres»-Nostalgie vor allem von Kürbis ernähren. Dieser ist nämlich auch bei höheren Temperaturen haltbar und hat deshalb die anderen Gemüse mittlerweile weitgehend ausgestochen, da diese bereits kurz nach dem Einkauf anfangen zu faulen. Zum Glück versteht es die Köchin, mit Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen vielfältige Varianten zu zaubern. Und dann gibt es ja noch Süsskartoffeln und Brotfrüchte…
Der fehlende Kühlschrank führt aber auch zu einer schlechten Resteverwertung: In der Regel sind die Linsen, die Nudeln oder der Reis vom Vorabend bereits am Morgen nicht mehr geniessbar. Was während der nächtlichen Wachen nicht gegessen wurde, geht notgedrungen direkt zu den Fischen, denn meistens ziehen die Nach-Mitternachts-Hungrigen ein Stück Brot mit Erdnussbutter den kalten Resten vor. Zum Frühstück gibt es dann aber selten Brot, sondern in der Regel Haferbrei.

Mit dem Kalfaterhammer stopft der Kapitän Werg in die Ritzen zwischen den Decksplanken und giesst diese dann mit Teer aus.
Eine segelnde Werkstatt
Während der Nachtwachen gibt es ausser dem Bedienen der Segel und dem Abwasch praktisch nichts zu tun. Oft unterhält man sich, erzählt vom Leben ausserhalb des Schiffs oder döst zwischendurch etwas an Deck. Die Wachen tagsüber sind hingegen zum Arbeiten da: Das Schiff ist buchstäblich eine segelnde Werkstatt. Schon die früheren Frachtsegler hatten neben dem Bootsmann – heute würde man ihn als Bordingenieur betiteln – auch einen Segelmacher an Bord. Das Rigg ist eine komplexe Maschine, in der dauernd Tauwerk kaputt geht und ausgetauscht werden muss, oder in der auch Holzteile brechen. So musste unser Bootsmann nicht nur eine neue Festmacherklampe bauen als Ersatz für jene, die im Hafen von Santa Cruz de la Palma zerstört wurde, sondern auch einen neuen Gaffelfuss, da dieser brach, als auf dem Törn zu den kanarischen Inseln das Gaffelfall riss. Oder eines Tages sitzt der Kapitän auf dem Deck, stopft Ritzen mit Werg und giesst diesen mit Teer zu. Oft spleissen wir Augen in Seile und binden die Enden mit Taklingen ab: Was im Rigg kaputt geht, verarbeiten wir weiter zu Stropps, mit denen man alles mögliche im Laderaum oder an Deck festlaschen kann. Nicht zuletzt muss nach der verrückten Nacht vor Santa Marta das Bramsegel an Deck geholt und genäht werden – von Hand…
Hinzu kommt, dass von Holz über Metall bis zu den Kunststoffen alle Materialien unter den salzig-feuchten Bedingungen und der intensiven Sonne leiden. Als ich zum ersten Mal etwas nähen musste, stellte ich fest, dass der Faden von meinem Nähzeug verschimmelt und die Nadeln rostig sind. Also gibt es im Aufbau am Heck links und rechts je einen Schrank. Der an Steuerbord ist mit Teer, Farben, Terpentin, Leinöl, Pinseln und Lappen vollgestopft, um dem fortlaufenden Alterungsprozess des Schiffs Paroli zu bieten. Jener an Backbord ist die Toilette. Diese ist mit 60 cm Tiefe gerade so breit, dass Normalgewichtige das Klo benützen können und dabei bei Seegang genug Enge haben, um sich abstützen zu können.
Dass wir für die anfallenden Unterhaltsarbeiten von der Handhobelmaschine und der Flex über die Stichsäge bis zum Schweissgerät alles Erdenkliche an Werkzeug an Bord haben – ganz zu schweigen von den vielen Ersatzteilen und -seilen –, nimmt nicht zuletzt Raum für Mannschaft und Fracht weg. Und in den Häfen bedeuten die Arbeiten, dass wir weniger Landgang haben. Das hat auch schon zu Diskussionen an Bord geführt. Aber bereits die früheren Frachtsegelschiffe vermieden möglichst, unterwegs kostspielige fremde Hilfe für Reparaturen in Anspruch nehmen zu müssen. Und auch Dieselmotoren funktionieren nicht ohne Unterhalt.
Auch die Kommunikation und der Papierkram müssen stimmen
Abgeschliffene Hände, Schlafmangel, erschwerte Hygiene, Manöverstress, eingeschränkter Landgang – neben all den bereichernden und spannenden Seiten der Reise nehmen wir für die «Vision Frachtsegeln» erhebliche Strapazen in Kauf. Die «Tres Hombres» ist wohl der nachhaltigste Weg, das Leben unbequem zu machen. Der Protest gegen den viel zu billigen und deshalb unglaublich dreckigen, konventionellen Transport auf See funktioniert aber nur, wenn die Segelfracht-Kunden zufrieden sind. Dafür halten wir mit unserem Engagement das Schiff am Laufen. Wenn man dann in irgendwelchen externen Büros aus Nachlässigkeit oder Desinteresse das Telefon nicht abnimmt, Mails nicht beantwortet und so unnötige Kosten verursacht und so den Nutzen für die Kunden verbockt, dann ärgert dies auch uns an Bord.

Das Foto der «Tres Hombres» hängt prominent im Büro der Grenada Chocolate Company.
Bei den Schokoladenproduzenten auf der Gewürzinsel
Quälend heult der Motor des Beiboots, das an Steuerbord längsseits festgemacht die «Tres Hombres» durch die karibische See schleppt. In Sichtweite voraus ein paar schüchterne Schaumkrönchen. Es sind diese Wellen, die Kapitän Wiebe zum Aussetzen des Dingi veranlasst haben. Vorangegangen ist eine lange Wache in der Flaute. Jeder kleinste Hauch weckte Hoffnungen. Unzählige Male haben wir die Rahsegel in eine neue Position gebrasst, die Schoten der Vorsegel umgehängt, den Baum des Grossegels dorthin gedrückt, wo man das Lee vermuten konnte. Der Effekt war nicht null, sondern sogar negativ: Strömung und Wellen trieben das Schiff in die falsche Richtung. Teilweise konnten wir das auf dem Wasser treibende Seekraut auf seinem Weg vom Heck zum Bug verfolgen, wir fuhren rückwärts. Die Insel St. Vincent hatte uns auf dem Weg von Martinique nach Grenada den vom Atlantik her wehenden Passat total aus den Segeln genommen.
Und dann im Feldstecher die Wellen in ein paar hundert Metern, vielleicht einem Kilometer Distanz. Wellen bedeuten Wind. Weiter herumdümpeln oder wieder segeln? Also haben wir die Segel alle geborgen, um möglichst wenig Widerstand zu haben, und das Dingi ins Wasser gelassen – auch wenn auf einem betont motorlosen Schiff dieses Aussenborder-Vollgasröhren schmerzt. Zehn Minuten später dann der Befehl zum Segelsetzen. Das Schiff krängt, nimmt Fahrt auf, «Fünf Knoten in die richtige Richtung», jubelt Wiebe am Ruder.
Wir haben für die Aktion – es war bereits die zweite solche an diesem Morgen – rund eine Füllung des 30 Liter Benzin fassenden Tanks verbraucht. Ein Schönheitsfehler in der reinen Lehre des emissionsfreien Transports, aber ein Klacks wenn man die Relationen anschaut: 370 Millionen Tonnen schmutziges Schweröl werden aktuell jährlich in Schiffsmotoren verbraucht. Ein einziger 18’000-TEU-Containerfrachter verbrennt auf der Hauptmaschine von rund 100’000 PS je nach Geschwindigkeit 120 bis 220 Tonnen Schweröl pro Tag. Hinzu kommen die Hilfsmotoren mit 20’000 PS, die unter anderem den Strom für die Kühlcontainer liefern. Da geht es um gigantische Mengen.
Alternative Treibstoffe?
Langsam dämmert es auch der Schifffahrt, dass man sich Gedanken zu den Treibhausgasen machen muss. Die Ideen bewegen sich vor allem auf zwei Ebenen:
Erstens arbeitet man an der Effizienz mit besseren Rumpfformen, oder der Idee, durch eine Art Blasenteppich den Reibungswiderstand im Wasser zu senken. Hinzu kommt Software zum sparsameren Sprit-Einsatz oder für optimierte Routen, damit der Motor nicht gegen Wind und Wellen ankämpfen muss.
Zweitens setzt man grosse Erwartungen in neue Treibstoffe. Im Vordergrund steht derzeit LNG, verflüssigtes Erdgas. Dieses verursacht zwar weniger Russ, Feinstaub und Schwefelausstoss. Aber es handelt sich weiterhin um einen fossilen Brennstoff. Beim CO2 gewinnt man zu wenig Reduktion, um die anderen Nachteile aufzuwiegen: So besteht die Gefahr des Methan-Schlupfs, entweder direkt bei der Verbrennung im Motor oder bereits früher beim Tanken oder der Gewinnung des Erdgases. Methan ist rund dreissig mal klimaschädlicher als CO2. Somit «würden die CO2-Vorteile des Gasantriebes (…) hinfällig“, stellt der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags fest. Hinzu kommt, dass man LNG in Amerika durch Fracking gewinnt. Man muss also die dabei entstehenden Umweltschäden mit berücksichtigen. Zudem erfordert das Herunterkühlen des Gases auf minus 164 Grad Celsius eine Menge Energie, und an Bord nimmt die dicke Tank-Isolation wertvollen Stauraum weg.
An Land ist LNG bereits umstritten. so wurde im September 2019 bekannt, dass gemäss einer Studie im Auftrag der niederländischen Regierung LNG-Lastwagen eine schlechtere Umweltbilanz aufweisen als Diesel-Lastwagen. So dürfte die Umrüstung auf LNG bei Binnenschiffen zwar für die Anwohner von Rhein und anderen Wasserstrassen eine geringere Schadstoffbelastung bedeuten. Aber die Klimaprobleme des Transports auf See löst es nicht. Anders sähe es aus, wenn man verflüssigtes Biogas verbrennen würde. Das wäre klimaneutral. Doch woher soll man die Flächen für den Anbau der notwendigen Biomasse nehmen, um den gewaltigen Treibstoffbedarf zu decken?
Eine weitere Idee basiert darauf, mit Strom Wasserstoff herzustellen. Diesen könnte man in künstliches LNG umwandeln oder per Brennstoffzellen als Schiffstreibstoff einsetzen. Doch dafür dürfte – mal abgesehen vom Platz für die Kraftwerke – die Zeit fehlen. So erklärte Matthis Becker, Geschäftsführer Deutschland des Schiffsmotorenherstellers Wärtsilä, im Jahr 2017: «Es wird noch gute 20 Jahre brauchen, um alternative Antriebe zum Beispiel gegebenenfalls auch Wasserstoff als Brennstoff für die Schifffahrt effizient zu machen. Denn im Massenmarkt, also im Container-, Tanker- und Bulkerbetrieb, brauchen wir große Leistung zu kleinen Preisen. Und diese Entwicklung wird noch einige Zeit dauern.»
Wie nicht zuletzt die historisch einmalig verheerenden Buschbrände in Australien zeigen, haben wir diese Zeit aber nicht mehr: Die Klimaerwärmung nimmt schneller Fahrt auf als die Ingenieure neue Antriebe zur Markt- und Praxis-Reife entwickeln können. Also empfehlen sich entweder bekannte Technologien wie beispielsweise Segel. Oder man reduziert die Menge, die täglich rund um den Globus geschippert wird. Am besten beides, denn die bisher diskutierten Möglichkeiten, die Klimagas-Emissionen der Seefahrt zu senken, werden nicht einmal ausreichen, das bis 2050 prognostizierte Wachstum des Frachtvolumens zu kompensieren. Da rechnet man mit einer Zunahme in der Grössenordnung des Drei- bis Vierfachen…

Edmond Brown, Chocolatier der Grenada Chocolate Company, erklärt den Produktionsprozess.
Bio-Schokoladen-Manufaktur
Hier auf Grenada hatte ich am Sonntag frei. Doch sonntags ist hier alles, aber auch wirklich alles geschlossen. Also habe ich das Schokoladenhaus nur von aussen gesehen, darunter die Tafel im Schaufenster, wonach der grösste Teil der Schokolade lokal verkauft wird, der andere Teil aber mit «dem einzigen Segel-Frachtschiff der Welt» der «Tres Hombres» nach England und Holland geschickt werde. Mittlerweile ist die «Tres Hombres» nicht mehr allein, und aktuell werden wir hier keine Schokolade laden, nachdem die Gründer der Grenada Chocolate Company gestorben sind und es keine Importeure in Europa gibt, welche die Schokolade weiter abnehmen.
Wir haben dann an einem Nachmittag die kleine Manufaktur im Norden der Insel besucht. Das Besondere an der Grenada Chocolate Company ist, dass sie die Schokolade hier im Land produziert. Sonst herrscht weltweit das Modell vor, dass die Länder im Süden die Kakaobohnen produzieren und die Verarbeitungsschritte mit höheren Wertschöpfung, also die eigentliche Herstellung der Schokolade, dann in den reichen Ländern des Nordens stattfinden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man die Kakaobohnen von den 32 Bio-Produzenten – diese halten 20 Prozent der Aktien – ohne lange Transportwege frisch verarbeitet. Dabei schafft es die Grenada Chocolate Company, ansprechende Ware zu produzieren. Zertifikate von Qualiäts-Wettbewerben zieren die Wände. Stolz führt uns der Chocolatier als einer der beiden Hauptaktionäre durch die Produktionsräume. Täglich fünf Kartons Schokolade, alle Tafeln von Hand verpackt, schaffen 13 Arbeitsplätze.
Das kostet: Die Preise hier vor Ort entsprechen in etwa dem, was man in der Schweiz auch für eine Tafel Schokolade bezahlt. Abnehmer dürften vor allem die Kreuzfahrtschiffs-Touristen sein, die sich gern im kühlen Laden in der Stadt aufhalten. Sollte sich ein Importeur finden, der die Schokolade in Europa vermarkten will, müsste er intensive Informationsabeit leisten, um die höheren Preise zu begründen, denn der Transport ist aufwendig: Als die «Tres Hombres» die fertige Schokol ade transportierte, musste die Mannschaft, solange man in den Tropen segelte, täglich den Diesel-Generator anwerfen, um die Schokolade zu kühlen. Trotzdem zeigt unser Kapitän ein grosses Interesse daran, weiterhin gute Beziehungen zur Grenada Chocolate Company zu unterhalten: «Sie sie arbeiten im gleichen Geist wie wir.»

Die Kakaobohnen werden von Hand sortiert.
Die Firma Fairtransport lebt vom Rum
Fairtransport war von Anfang an auch eine Handelsgesellschaft. Nur von den Frachtpreisen könnte man mit dem kleinen Laderaum ökonomisch nicht überleben. Auch die Einnahmen durch die Trainees machen das Schiff nicht rentabel: Sind alle Plätze auf der jährlichen Atlantik-Rundfahrt besetzt und zieht man vom Umsatz die Kosten ab – wir essen sehr weitgehend die in der Regel teureren Bioprodukte – dürften die Einnahmen aus den Trainees nicht viel mehr als eine Stelle im Büro finanzieren. Dabei sollen die Prinzipien nicht verloren gehen: Als man vor ein paar Jahren nach einem Bericht im US-Fernsehen zwischen den Karibikinseln plötzlich viele US-Trainees auf kurzen Strecken hatte, löste dies eine kritische Diskussion aus: Den Tourismus will Fairtransport nicht fördern. Ergebnis: Die Aufenthaltsdauer in der Karibik und die Zahl der angelaufenen Inseln wurden reduziert.
Wirtschaftlich gesehen ist Fairtransport also vor allem eine Rum-Handelsgesellschaft, in der neben dem Handel mit einigen weiteren Produkten auch Fracht gesegelt wird. Dabei sind Handel und Segeln nicht voneinander zu trennen. Einerseits hat man mit dem Rum eine Ware mit relativ hohem Wert pro Gewicht entdeckt, was eine höhere Wertschöpfung ermöglicht. Andererseits erhält der Rum erst dadurch, dass er unter Segeln transportiert wird, jenes Alleinstellungsmerkmal auf dem Luxus-Spirituosenmarkt, das eine höhere Gewinnmarge ermöglicht. Zudem reift er in den Fässern zusätzlich, wenn diese im Schiff vom Atlantik-Seegang geschaukelt werden. Insgesamt hat Fairtransport für gesegelten Rum einen Markt geschaffen, dessen Nachfrage die «Tres Hombres» allein nicht befriedigen könnte. Somit gibt es Platz für weitere Frachtsegel-Projekte.

Erdrückende Grösse: Neben dem Kreuzfahrtschiff wirken die Häuser von St. George wie Miniaturen.
Freundliches Volk
Marktbesuch am Samstag Morgen. Ein Kreuzfahrtschiff hat seine Passagiere an Land entlassen, Einheimische und schamlos filmende und fotografierende Touristen halten sich die Waage. Der Markt hat sich stark auf die betuchte weisse Kundschaft ausgerichtet: Gewürz-Souvenierpackungen in allen Grössen oder Muskat-Halsketten – Grenada ist einer der grössten Muskatnuss-Produzenten –, angeboten von Frauen, die offensichtlich nicht zum begüterten Teil der Insel gehören.
Trotzdem ist Grenada vom Kreuzfahrtbusiness noch nicht so verdorben wie etwa La Palma oder Barbados. Zwar waren wir einen Abend im Restaurant, für das wir Ware hierher gebracht haben, und konnten einen Augenschein nehmen, wie hier die obere Mittelklasse lebt und sich vergnügt. Aber am Nationalfeiertag hatte ich erneut frei. Wieder alles geschlossen, auch Busse fuhren keine. Also nahm ich die Strasse – trotz Hauptverkehrsachse eher ein Strässchen – zu einem Naturreservat unter die eigenen Füsse. Überall in den Aussenquartieren und in den Dörfchen wollten die Leute wissen, woher ich komme, wohin ich wolle, nette kurze Gespräche, man wünscht sich einen guten Tag. Kein Anbaggern um Geld wie in Bern («Hesch mer ä chli Münz?») oder in Ghana («I am your friend, give me money»). Einzig eine Frau, die sich in farbige Tücher geworfen hatte, einen malerischen Früchtekorb auf dem Kopf trug und sich als «Banana-Lady» vorstellte, wollte zuerst fotografiert werden und fragte hinterher nach Geld, sie habe fünf Kinder zu versorgen. Erst die eigene Leistung, dann die Frage nach einem Obolus – so bewahrt sie sich ihre Würde. Im Gegensatz zu Barbados, wo vor ein Paar Jahren ein Mannschaftsmitglied am Strand Opfer eines Verbrechens wurde und traumatisiert die Reise abbrechen musste, fühle ich mich hier auf Grenada sicher.
Eine besondere «Entdeckung» machen wir im Nationalmuseum: Louise Helen Langdon Norton Little, Mutter des amerikanischen Aktivisten für die Rechte der Schwarzen, Malcolm X, stammte aus Grenada. Eine Serie von Schrifttafeln bezeichnet sie und ihren Sohn als «our heritage», ein Erbe, auf das man stolz ist in der Karibik.

Nationalstolz in der Heimat von Malcolm X: Selbst wenn der erste Stock eine Ruine ist, bemalt man Mauer zur Strasse mit den Nationalfarben Rot, Gelb und Grün.
Anspannung vor der Fahrt nach Kolumbien
Wenn wir nach ausführlichen Überholungsarbeiten am Schiff am Montag die gastfreundliche Insel verlassen, wird sich dieses entspannte Gefühl bald auflösen: Angesichts der verfahrenen Lage in Venezuela blüht an der Küste die Gelegenheits-Piraterie. Tagsüber sind die Boote als Fischer unterwegs, in der Nacht als Seeräuber. Auf dem Atlantik sind wir dann mit der «Tres Hombres» einer schwimmenden Fischfabrik aus Japan begegnet. «Man kann nur hoffen, dass das Öl zur Neige bevor sie alle Fische ausgerottet haben», kommentierte der erste Mate, selbst ein Fischer als Cornwall. Die venezolanischen Fischer-Piraten bewegen sich in der Tradition der Bukaniere Westindiens, die eigentlich von der Jagd auf den Inseln lebten und das Fleisch an Schiffsbesatzungen nverkauften. Als die Spanier dann eigene Jäger einsetzten, um den Bukanieren die Lebensgrundlage zu entziehen, wurden diese zu Piraten.
Die Ziele heutiger Seeräuber sind vor allem kleinere Schiffe, oft Yachten. Sie haben es auf Geld, Handys, Laptops und Navigationsgeräte abgesehen. Grosse Schiffe, wie sie vor Somalia, in den Gewässern zwischen Malaysia und Indonesien oder in der Bucht von Nigeria zum Beuteschema der Piraten gehören, wurden hier bisher nicht angegriffen.
Ich verstehe zwar, warum Fischer zu Piraten werden, schliesslich funktioniert der Welthandel ja bis heute so, dass die Bevölkerungsmehrheit der Länder im Süden permanent den Kürzeren zieht, sowohl was den Lebensstandard als auch die Perspektiven angeht. Bereits um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert finanzierte das Handelshaus Burckhardt aus Basel nicht nur Sklavenhandel, sondern auch Freibeuterschiffe. Unter französischer Flagge segelnd sollten sie im Krieg zwischen Frankreich und Grossbritannien englische Handelsschiffe abfangen, um so den Feind wirtschaftlich zu schwächen. Auch Schweizer Kapital wurde also nicht zuletzt durch Sklavenhandel und Piraterie akkumuliert. Doch persönlich für die legalen Raubzüge der Reichen auf Kosten der Armen bestraft zu werden, wenn letztere dann als Piraten an Bord kämen, das möchte ich dann doch nicht. Obschon wir einen weiten Bogen segeln werden, haben wir für alle Fälle die Anweisung, dass wir in keinem Fall Gegenwehr leisten sollen.

Grössen- und Machtverhältnisse: Die «Tres Hombres» bei den Containerkränen im Hafen von Bridgetown.
Seid realistisch, fordert das Unmögliche
Umarmungen, Adressen notieren, letzte Worte, dem Beiboot nachwinken: Gefühlsgeladene Momente, hier in Martinique gehen viele von Bord, mit denen wir gemeinsam den Atlantik überquert haben. Sie kehren zurück in den Alltag als Architektin, Physik-Doktorand oder Monteur für Kühlelemente oder treten eine weitere Etappe einer grossen Reise an. Die Vorahnung, dass dieser Abschied eines Tages auch mir selbst blühen wird, schmerzt. Und wenn man dann beim Landgang einen ehemaligen Mitsegler im teerverschmierten T-Shirt trifft, zeigt sich, dass er dem Dreck von Bord den grösseren emotionalen Wert zumisst als dem nagelneuen «Tres-Hombres»-Leibchen, das alle bei ihrem Abschied bekommen haben.
Neue Trainees werden kommen, müssen eingearbeitet werden, welche Schoten, Fallen und Brassen man wo belegt, welche Funktion die Geitaue und Gordinge haben, wie man die Segel setzt und birgt… Martinique ist als französisches Übersee-Departement gut erreichbar und eignet sich für einen solchen Wechsel.
Die Bucht, in der wir ankern, ist voll mit Yachten aus aller Herren Ländern (respektive Herrenländern). Die Strände entsprechen den Tourismusprospekten: Je nach Sonnenstand türkisfarbenes Wasser, dazu weisser Sand, sanfte Brandung und Palmen. Der Geldautomat bei der Post in St. Anne, einem kleinen Dorf im Süden der Insel, bedient mich sogar auf Deutsch – und das Preisniveau entspricht dem der Schweiz, wir sind in Frankreich, im tropischen Teil der EU. Souvenir-Boutique reiht sich an Souvenir-Boutique.
Ein Wanderweg durch ein Naturschutzgebiet erweist sich dagegen als Volltreffer: Fremde Bäume, Mangroven und vieles was bei uns als Zimmerpflanze zieht, wächst hier wild, nicht zuletzt die Schwiegermutterzungen. Einziger kleiner Schönheitsfehler: Jedesmal wenn ich auf einer Insel wandern gehe, werde ich verregnet, das war schon auf La Palma so. Dafür hatten wir auf dem Atlantik praktisch durchgehend Sonne. Und im Hafen von Bridgetown, als wir die Kartons mit den karibischen Pfeffersossen bei über 30 Grad am Schatten in der brennenden Sonne zum Schiff schleppten, hätte ich mir etwas Regen gewünscht.
Wir wurden immerhin Dritte…
Auf Barbados hatten wir ein «Rennen» gegen zwei grosse Schoner. Der eine ist uns richtig um die Ohren gesegelt, mit dem anderen konnten wir halbwegs mithalten. Abends dann ein Treffen am Strand mit den Mannschaften der beiden Schiffe. Dabei hat mir der Bordingenieur der «Ruth», ein pfiffiger Amerikaner aus Seattle, erklärt, Mohammed habe geschrieben, dass einem die Zeit, in der man auf einem hölzernen Schiff segelt, nicht von der Zeit abgezogen werde, die einem auf Erden zusteht. Sollte dies zutreffen, wirkt die «Tres Hombres» geradewegs lebensverlängernd…
Eigentlich hätten wir hier auf Martinique gleich von einem Boot empfangen werden sollen, das uns tiefer in die schmale Bucht geschleppt hätte. Das klappte aber wegen zu starken Nordwinds nicht. Also mussten die leeren Fässer, die wir in Dieppe an Bord genommen hatten, per Beiboot an Land. Um die mit Rum gefüllten wieder an Bord zu bekommen, werden wir später doch noch näher ans Ufer geschleppt.

Transport per Beiboot der leeren Rumfässer an Land, während die «Tres Hombres» vor Anker liegt.
Bisher auch im fairen Handel kein Thema
Der französische Bio-Wein, den wir hier abgeliefert haben, dürfte angesichts der teils gut betuchten Yacht-Touristen auf Nachfrage treffen. Ob dabei der Umstand, dass der Transport über den Atlantik weitgehend emissionsfrei erfolgte, sich zusätzlich in einem Preis-Aufschlag äussern kann, wird sich weisen. Bisher ist die Transportform kaum ein Thema bei den Konsumenten, einzig bei Flugfracht reagieren viele ablehnend.
Dabei zählen auch die Fairtrade-Organisationen zu den Verladern. So lebt man mit dem Widerspruch, bei den Projekten in Übersee darauf zu drängen, dass sie nicht nur sozial fair, sondern auch möglichst biologisch produzieren – und transportiert dann die Ware mit klimaschädlichen maritimen Dreckschleudern.

Begehrte Westfracht: Hier erreicht der in Dieppe geladene Biowein sein Ziel auf Martinique.
Es liegt also nicht zuletzt an den Verladern, die entsprechende Nachfrage zu erzeugen, beispielsweise durch ein Label für emissionsfreien Transport. Davon ist man aber selbst im fairen Handel noch weit entfernt: «Es gibt in den Fairtrade-Standards bisher keine Vorschriften, die sich auf den Transport beziehen», schreibt Andriau Deflorin, Pressesprecher der Stiftung Max Havelaar Schweiz auf Anfrage. Man fokussiere sich seit ihrer Gründung auf die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und Arbeiterinnen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen des Südens. «Aufgrund der bislang sehr kleinen Transportkapazitäten wäre ein Label für gesegelte Waren vorerst in einer sehr engen Marktnische angesiedelt. Ein solches Label wäre ein Alleinstellungsmerkmal für exklusive Produkte mit einer besonderen Geschichte und Herkunft.» Die grosse Frage ist, wer angesichts der immer drängenderen Klimaprobleme den ersten Schritt tut. Max Havelaar Schweiz verweist auf die Chancen: «Wir sind überzeugt, dass moderne Segelfrachter im Zuge der wachsenden Sensibilität für Nachhaltigkeit eine grössere Bedeutung erhalten werden und auch Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz sich für entsprechend transportierte Waren interessieren werden.»
Seefracht ist heute fast gratis
Deflorin rät, sich bezüglich emissionsarmer Transporte an die grossen Retailer zu wenden Entsprechend wollte ich unter anderem von Coop und Migros nicht zuletzt wissen, welchen Anteil die Frachtkosten am Endpreis haben, wie weit also eine Umstellung auf Segeltransport beispielsweise Kaffee oder Schokolade für die Konsumenten verteuern würde. Direkt auf diese Frage eingegangen ist niemand. Aber man kann sich ausrechnen, dass die eigentliche Seefracht nur geringen Einfluss auf die Endpreise hat: So kostete im Oktober 2019 ein 40-Fuss-Container von Veracruz (Mexiko) nach Hamburg 649 Euro (www.icontainers.com/de/container-verschiffen/deutschland/). Nach Bremerhaven wären es sogar nur 536 Euro gewesen. Die Kiste fasst ein Volumen von rund 67 Kubikmeter. Bei einem spezifischen Schüttgut-Gewicht von im Durchschnitt 0,55 für grüne Kaffeebohnen kann man damit 36 Tonnen Kaffee transportieren. Das ergibt von Mexiko nach Hamburg einen reinen Seefrachtpreis – also ohne Zu- und Wegfahrten an Land, Krangebühren, Hafen- und Verzollungskosten etc. – von weniger als einem Rappen pro Kilo. Wenn durch den Transport unter Segeln die Frachtkosten sich verfünf- oder verzehnfachen und auch die Logistik-Kette komplexer wird – man kann nicht einfach den Container auf ein Binnenschiff, einen Bahn- oder Lastwagen setzen, sondern muss Stückgut umladen –, würde dies die Tasse Kaffee zwar verteuern. Aber angesichts des kleinen Anteils, den der Transport am Endpreis ausmachen, dürfte sich dies im einstelligen Prozentbereich bewegen. Dafür bekäme man Kostenwahrheit. Davon kann man heute angesichts der ökologischen Schäden nicht sprechen
Billig auf Kosten der Umwelt
Dominik Bangerter, Geschäftsleitungsmitglied von Blaser Café schreibt auf Anfrage, er sehe insgesamt Schwierigkeiten für ein Segeltransport-Label. Von Santos (Brasilien) nach Hamburg betrage der Frachtanteil am Rohkaffeepreis zwischen 2 und 4 Prozent. Das ergibt einen Widerspruch zu meiner Berechnung, der vermutlich darin liegt – hier vor Anker in Martinique mit wenigen Stunden Landgang kann ich dies nicht abschliessend klären –, dass darin nicht nur die reinen Container-Preise enthalten sind. Bangerter verweist weiter auf die längeren Transportzeiten unter Segel, die sich negativ auf die Qualität auswirken könnten. Zudem werde der Kaffee im Ursprungshafen bei Lieferung bezahlt und Blaser bekomme ihn erst vergütet wenn er beim Kunden angekommen ist. Mit anderen Worten: Das Kapital ist länger gebunden – eine logische Überlegung innerhalb der heutigen Marktstrukturen. Diese sind eben nicht geeignet, die Klimaerwärmung zu begrenzen.
Coop, die sich sich selber unter den Grossverteilern als Bio-Pionier sieht, wimmelt ab: «Wir äussern uns aus Konkurrenzgründen grundsätzlich nicht zur Kostenstruktur einzelner Produktsegmente», schreibt Mediensprecherin Rebecca Veiga und verweist auf die allgemeinen CO2-Strategie von Coop. Dort findet man zum Thema Transport Elektrolastwagen, weniger Luftfracht, Verlagerung von der Strasse auf die Bahn… Alles schön und gut, doch kein Wort zur Seefracht. Die maritime Transportbranche hat es offenbar nicht nur bei Klimakonferenzen geschafft, sich unauffällig wegzuducken, sondern auch bei den Kunden.
Migros hat sich schon mal erkundigt
Eine ausführlichere Antwort kam von der Migros. Die gesamten Transportkosten würden aktuell 2,5 bis 3,5 Prozent des Ladenpreises ausmachen, erklärt Mediensprecher Patrick Stöpper. Darin sind dann auch die teureren Transporte innerhalb der Schweiz enthalten, etwa von den Verteilzentren in die Filialen. Zur Seefracht berichtet er, der Migros-Verarbeitungsbetrieb Delica habe das Thema Segelfracht vor zwei Jahren schon einmal geprüft. «Die Frachtkosten überstiegen damals die Erwartungen massiv. Weiter könnte sich die lange Transportzeit auf die Qualität der Kaffeebohnen negativ auswirken». Gesegelter Kaffee bleibe vorläufig ein Nischenmarkt.
Wenn Delica bei den bestehenden kleinen, mit traditionellem Rigg ausgestatteten Schiffen angefragt hat, dann dürfte dies zutreffen. Und die modernen Schiffe, die massiv weniger Mannschaft und Unterhalt erfordern, gibt es ja noch nicht – die alte Geschichte vom Huhn und vom Ei.
Pronatec plant eine erste Ladung
Dagegen zeigt der Bio- und Fairtrade-Importeur Pronatec aus Winterthur Engagement: Hier in Martinique erreicht mich die gute Nachricht, dass Nicolas Merky den Auftrag hat, probeweise eine erste Ladung mit Fairtransport zu organisieren. Dabei geht es erst einmal um eine Tonne Zucker aus Kolumbien. Falls diese ohne Salzwasserschäden ankommt und es mit dem ganzen Ex- und Import-Papierkram glatt läuft, könnten grössere Aufträge folgen. «Dieser Zucker ist für uns ein erster Test für den Ablauf. Wir werden diese Tonne Zucker voraussichtlich überhaupt nicht kostendeckend verkaufen können. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen», schreibt Merky. «Wir hoffen, nächstes Mal eine grössere Charge transportieren zu können, die man Kunden dann explizit als Segelware anbieten kann.» Logischerweise wird Pronatec den ökologischen Mehrwert der entsprechenden Ware betonen müssen. Das könnte helfen, auch in der Schweiz den Blick dafür zu schärfen, was das heutige Wirtschaftssystem unter anderem auf den Weltmeeren anrichtet.
Auch geografisch widersinnig
Interessant ist, was Stöpper über andere Bemühungen der Migros zur CO2-Senkung schreibt: «Hinsichtlich Seefracht reduzieren wir konsequent die Verkehrswege, indem wir circa 50 Prozent des Warenverkehrs aus Fernost via Südhäfen abwickeln und damit weite Distanzen auf dem Seeweg verhindern.» Der klassische Weg von Fernost auf die europäischen Märkte läuft nämlich über die Nordhäfen. So kommen die Containerschiffe durch den Suezkanal, lassen Italien an Steuerbord liegen und fahren durch die Strasse von Gibraltar um den ganzen Kontinent herum. Das Umschlagsvolumen im Hafen ist also ökonomisch entscheidender als die zurückgelegte Distanz auf See, denn der Treibstoff ist billig. Auch das Handy, das T-Shirt oder der Fernseher für Mailand oder Rom wird somit in der Regel in Rotterdam oder Antwerpen gelöscht. Dann nimmt die Ware den Weg durch die Alpen nach Italien – ökologisch widersinnig! Die Achse Rotterdam-Genua ist unter der Bezeichnung «Korridor 24» eine Haupt-Güterverkehrsachse Europas. «Experten rechnen mit einem weitern Anstieg des Warenumschlags im Korridor 24. Unter anderem, weil der Hafen Rotterdam als wichtigster Eingangspunkt für Waren aus Übersee in den kommenden 20 Jahren weiter ausgebaut werden soll», schreibt die Eidgenössisch Technische Hochschule ETH.
Die Südhäfen wie beispielsweise Genua galten lange als zu streikfreudig, die Hafen- und Bahnlogistik als zu unzuverlässig. Hört man sich in der Logistikbranche um, so wird reihum bestätigt, dass Migros sich für den Aufbau einer Transportroute über die Südhäfen stark gemacht hat. Dabei soll es nicht nur um CO2 gegangen sein, sondern primär auch um Kostensenkung. Bis die neue Route aber wirklich funktionierte und sich ein regelmässiger Schiffsverkehr zwischen Fernost und Italiens Häfen etablierte, habe es Jahre gedauert. Unter anderem sei entscheidend gewesen, dass Nestlé für die Fracht in der Gegenrichtung gewonnen wurde. Das Beispiel zeigt, dass selbst für geografisch logische Lösungen mit konventioneller Containertechnik ein Mindest-Frachtvolumen nötig ist, damit sie umgesetzt werden. Das gleiche gilt für innovative Segelfrachter: Erst wenn eine kritische Masse erreicht ist, können sich regelmässige Segel-Frachtrouten etablieren.
Die Ankerwinsch auf der «Tres Hombres» könnte man ohne weiteres an ein Fitness-Studio vermieten.
Da kommt der Rum ins Schwimmen
Hoch auf dem Fass am Strand von St. Anne auf Martinique erklärt Raphael von «Frères de la Côte» dem aufmerksamen Publikum, welche Umweltprobleme der Transport mit Schweröl verursacht und was die «Tes Hombres» an Alternativen aufzeigt. Raphael ist der Bruder von François, der während der stürmischen Fahrt in der Nordsee nebenher noch Brot gebacken hat (siehe «Blog aus Dieppe»).
Viele sind gekommen, um den Rum zu kosten, andere tragen unter dem Hemd Badekleider und neben den Fässern liegen Flossen und Schwimmbrillen. Dann rollt ein Fass nach dem anderen in die salzige Karibiksee. Dutzende Handys und Gopro-Kameras halten den fröhlichen Anlass fest. Alkohol ist leichter als Wasser, die Fässer gehen knapp nicht unter. Schwimmerinnen und Schwimmer nehmen den Rum in Obhut, stossen die Fässer vor sich her. Die Strecke bis zur «Tres Hombres» beträgt rund ein Kilometer. Unter diesen Bedingungen im fast badewannenwarmen Wasser zu zweit oder zu dritt ein rund eine Vierteltonne wiegendes Fass durchs Wasser zu stossen, das treibt den Schweiss: Lachend nehmen die «Aussenbordmotoren» der Fässer die Süsswasserflasche entgegen, trinken in grossen Schlucken. Trotzdem frotzelt einer, er hätte lieber Rum…
Nach fünfzig Minuten erreicht das erste Fass das Schiff. Die Schwimmenden hängen die Haken mit den drei Flaschenzügen ein, dann liegt die Verantwortung bei der Mannschaft an Bord. Langsam entwindet sich das Fass dem Meer, klettert die Bordwand empor, bekommt zum Empfang eine Süsswasserdusche und verschwindet vorsichtig geführt im Laderaum.
Eine gemeinsames Mahl an Bord besiegelt die mehrstündige Aktion. «Die Tres Hombres segelt nicht nur Fracht, sondern sieht ihr Ziel auch darin, Menschen zusammenzubringen», betont Kapitän Wiebe beim Umtrunk. Dies geschieht auf mehreren Ebenen: Auch der Erlös aus dem geschwommenen Rum soll in Europa den Umbau des von den Frères de la Côte geplanten grösseren Frachtseglers finanzieren helfen – ein weiteres Schiff in der Cargosailing-Familie. Und ganz unmittelbar vor Ort blättern mehrere SchwimmerInnen interessiert im Denknetz-Jahrbuch zum Thema Umweltzerstörung durch den Welthandel. Sie bedauern aber, dass nicht mehr Artikel auf französisch sind…

Demonstrativ emissionsfrei: SchwimmerInnen transportieren die vollen Rumfässer zur «Tres Hombres».
Reine Lehre oder ökonomische Effizienz?
Hier in Martinique haben wir nun also den Wein abgeliefert, den wir in Dieppe an Bord genommen haben. In der Regel gibt es zu wenig Fracht in Richtung Westen für die Segelschiffe. Dabei hatten wir von Den Helder bis nach Baiona ein Tandem an Bord, dessen Transport den Eigentümer billiger kam als wenn als wenn er das Velo per Post geschickt hätte.
Die transatlantische Segelfracht läuft also derzeit noch vor allem mit klassischen Kolonialwaren von West nach Ost. Der Wein, den wir abgeliefert haben, soll helfen, ein Segelfrachtprojekt der Partnerorganisation Frères de la Côte zu finanzieren. Und gestern Sonntag ist mit «De Gallant» ein weiteres Schiff bei uns längsseits gekommen, das neben Passagier- auch Frachttransporte anbietet. Solche Mischkonzepte verbreitern die von der «Tres Hombres» ausgelöste Bewegung. So ist der Honig, den wir an Bord essen, ursprünglich von einer Yacht von Spanien nach Holland gesegelt worden. Und der eine Schoner, gegen den wir vor Barbados das Freundschaftsrennen segelten, soll später das Rigg für den Frachtschiff-Neubau «Ceiba» nach Costa Rica bringen.
Die «De Gallant» ist ein Stahlschiff, älter als die «Tres Hombres» und nur klein wenig grösser. Der ursprünglich holländische Schoner fährt heute unter französischer Flagge und kann aktuell 35 Tonnen laden. Bei uns hing auf dem Achterschiff ein Grill aussenbords und beim gemeinsamen Mahl auch mit den «Frères de la Còte» wurde die Freundschaft zelebriert, die angesichts häufiger Spannungen in der Segelfrachtbewegung wichtig ist. Die «De Gallant» wird unter anderem auch nach Kolumbien segeln, um dort Kaffee an Bord zu nehmen, «für Fairtransport» erklärt ein Crewmitglied. Da diese alten Schiffe nur kleine Mengen transportieren können, gibt man sich gegenseitig Aufträge weiter – wie in einer Familie. Dch so wie Familien nur theoretisch harmonische Lebensformen sind, gibt es auch Reibereien und Diskussionen zwischen den verschiedenen Projekten, beispielsweise wenn ein Auftrag dann nicht mehr zurückkommt, der Segelschiffpartner den Frachtkunden dauerhaft bei sich behält – und so zum Konkurrenten wird.
Die Diskussionen betreffen auch das Konzept: So radikal und revolutionär wie die Schiffe von Fairtransport, die demonstrativ auf den Motor ganz verzichten, ist sonst meines Wissens niemand. Auch die «De Gallant» holte die Segel 100 Meter vor unseren Schiff herunter und legte praktischerweise unter Motor an. Da kommt es dann darauf an, WIE man den Motor einsetzt. Nur zum stressfreien manövrieren im Hafen? Oder dampft man fossil bei ungünstigem Wind auch mal tagelang gegen Wind und Wellen an? Wer tiefer als die «Tres Hombres» in die Karibik hinein segelt oder gar bis Mexiko geht, wird auf der Rückreise um tagelange Motorfahrt kaum herumkommen, denn die Schiffe laufen viel weniger «Höhe» – also Strecke gegen den Wind – als eine Yacht. Was heisst dann noch «emissionsfrei»?
Die sich daraus ergebenden Differenzen um Motoren und Konzepte erinnern mich lebhaft an die damaligen Auseinandersetzungen zu Beginn der Fairtrade-Bewegung wie etwa die Fragen: Wer importiert den revolutionärsten Kaffee aus Nicaragua? Welche Informationsarbeit ist damit verbunden? Dabei ging es jeweils um ökonomisch marginale Mengen. Später kam dann die Verbreiterung und damit die Verwässerung: Fairtrade-Labelware gibts nun fast in jedem Supermarkt, Informationsarbeit ist dagegen passé. Dafür hat die Idee des fairen Handels die Nische verlassen, es geht um tausende von Tonnen. Neue Entwicklungen entstehen eben in der Regel am Rand, müssen aber, um mehr Wirkung zu entfalten, den Weg in die Mitte der Gesellschaft finden. Eine ähnliche Entwicklung ist aus klimapolitischen Gründen auch bei der Idee des emissionsfreien Transports zu erhoffen, selbst wenn es dann für die Pioniere schmerzhaft sein wird, wenn andere aus ihrer mit viel Anstrengungen erkämpften Idee ein ideologisch verdünntes Geschäft machen.
Dass aber Pioniere als Erbe nicht zuletzt Stolz hinterlassen, zeigt hier auf Martinique die Gemeinde St. Anne: Im ganzen Dorf hängen grossformatige Fotos schwarzer Persönlichkeiten. Von Leopold Senghor bis zum als Sklaven geborenen US-Abolitionisten Frederick Douglass, von Aime Césaire bis zu Nelson Mandela, von der martiniquesischen Journalistin und Autorin Paulette Nardal bis zum Gründer der Arbeiterpartei von Barbados, Grantley Herbert Adams. Eine Demonstration schwarzen Selbstbewusstseins inmitten der weissen Gäste von den Yachten, eine Sammlung von Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Bestehenden zufrieden gaben und oft das unmöglich Scheinende verlangten. Vielleicht wird das Bild der «Tres Hombres» in wenigen Jahren in den dannzumal entstandenen Klimamuseen hängen…

Demonstration schwarzen Selbstbewusstseins auf Martinique: Fotos in den Strassen von St. Anne.

So friedlich kann das Segeln im Passat sein.
Kriegsfischkutter auf Friedensfahrt
Zack – ein Schlag auf die Brust. So fühlt es sich also an, wenn man nachts einem fliegenden Fisch in die Quere kommt. Unklar ist, wer mehr erschrocken ist, der Fisch oder ich. Wir befördern ihn zurück ins Wasser. So hat er Glück gehabt, denn wir finden immer wieder fliegende Fische, die unbemerkt an Deck gelandet und dann verendet sind. Auch ein kleiner Tintenfisch lag schon an da, vermutlich haben ihn Seevögel dahin fallen lassen.
Am 24. Dezember überraschte uns eine riesige Truppe Delfine, es müssen mehr als 50 gewesen sein. Oft überholten sie das Schiff ganz nahe, knapp unter der Oberfläche, so dass wir die Flecken auf ihrem Rumpf erkennen konnten. Und am Weihnachtstag stand während unseres Festessens plötzlich ein verschüchterter, vermutlich verirrter Silberreiher an Deck – eigentlich ein Küstenvogel. Er blieb rund zwei Stunden, war wohl erschöpft, zugleich aber verunsichert ob der Musik und dem lauten Lachen. Dann war er wieder weg. Dabei hatten wir uns schon überlegt, wie wir ihn bis Barbados durchfüttern könnten, beispielsweise mit fliegenden Fischen, die an Deck landen.

Dieser fliegende Fisch ist vor einem Raubfisch in die Luft geflohen und hatte das Pech, statt wieder im Wasser bei uns an Deck zu landen.
Am Tag zuvor war die Köchin gerade dabei, sich auf dem Vordeck die Haare zu waschen, als sie feststellte, dass sie mit dem Eimer nicht nur Wasser, sondern auch jede Menge durchsichtige Wesen aus dem Atlantik geholt hatte. Rund drei Zentimeter lang, mit dunklen Stellen im Körper – wir rätselten, ob dies das das Herz oder das Hirn sei – schwammen sie, indem sie ihren sackartigen Körper zusammenzogen und so das Wasser hinten ausstiessen. Junge Quallen? Jedenfalls eine eigenartige Vorstellung, dass wir, wenn wir im Dunkeln abwaschen, solche Tiere im Abwaschwasser haben könnten. Dass unser Abwaschbecken lebt, merken wir daran, dass manchmal in der Dunkelheit ein gestresstes Leuchtplankton kurz aufblitzt, wenn wir die Bürste, Besteck oder einen Teller eintauchen.
An Heiligabend überholte uns eine grosse Gruppe Delfine.
Rar gemacht haben sich dagegen bisher die Wale. Dabei hatte Andreas schon in der Biskaya erzählt, dass die «Tres Hombres» vor zwei Jahren mitten im, Atlantik einen Wal überfahren hat. Zuerst habe es gerumpelt und dann im ganzen Rumpf geknirscht, wie wenn man auf eine Sandbank auffahren würde. Im Heckwasser sei dann ein Wal aufgetaucht mit einem Striemen über den Rücken, habe geblasen und sei dann abgetaucht. Er hatte offenbar die «Tres Hombres», ein fast geräuschlos fahrendes Schiff, nicht kommen hören: Ein Drittel der Meeressäuger haben irreversible Gehörschäden, schreibt Alliance Sud, der Zusammenschluss der Schweizerischen Hilfswerke. Dazu tragen die Containerschiffe kräftig bei: Die Blechkisten sind in Führungsschienen übereinander gestapelt und haben in diesen etwas Spiel. Wenn dann auf See über zehntausend Container in den Schienen hin und her schlackern, macht das einen Höllenkrach, der sich unter Wasser stärker überträgt als in der Luft. Hinzu kommt der Lärm der Motoren. «Aber Amazone und deren Kunden ist das egal», meinte Andreas trocken.

Bei der Sicherheitsübung wird auch der Überlebensanzug demonstriert.
Dunkle Vergangenheit
Nicht immer war unser Schiff so friedlich unterwegs: Als die Nazis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs schnell grosse Teile Europas überrannten, hatten sie plötzlich zu wenig Schiffe, um die nun sehr langen Küsten zu überwachen. Sie entschlossen sich, diese Lücke durch den Bau kleiner Schiffe mit einem Holzrumpf auf Stahlspanten zu schliessen. Diese sollten dann später im Frieden als Fischkutter eingesetzt werden, waren aber für den Krieg unter anderem mit einer Kanone auf dem Vordeck bewaffnet. Der Rumpf war in Schlepptankversuchen optimiert worden, was den rund 24 Meter langen Schiffen eine gute Seetüchtigkeit verlieh. In grossen Serien wurden während des Kriegs über 600 dieser Allzweckboote – Hafenbewachung, Geleitschutz, Minenräumung, Materialtransport – gebaut. Auf der Baunummer 368 segeln wir heute über den Atlantik.
Nach dem Krieg haben die Alliierten diese Kriegsfischkutter beschlagnahmt, wobei die Westmächte sie dann an deutsche Fischer vercharterten oder sie als Minensuchboote einsetzten. Gemäss einem Buch über diesen Schiffstyp an Bord der «Tres Hombres» sank die Nummer 368 mindestens zweimal: einmal während des Kriegs im Oslofjord und dann im Januar 1965 beim Leuchtturm Rixhöft. Bis dahin war das Schiff mehrmals umgebaut worden, hiess zuerst «Edith» und dann «Anneliese». Es teilte damit das Schicksal vieler dieser Schiffe, die entweder wirklich als Fischerboote eingesetzt wurden oder zu Motor- oder Segelyachten umgerüstet wurden.
Was nach der Veröffentlichung des besagten Buchs geschah, ist unklar. Irgendwann zu Beginn des 21. Jahrhunderts entdeckten drei «Verrückte», die sich in den Kopf gesetzt hatten, Fracht unter Segeln zu transportieren, den halb verrotteten Rumpf und erstanden ihn für 3000 Euros. Damit begann die neue Karriere des ehemaligen Naziboots als die «Tres Hombres», die nun demonstriert, wie Waren im Frieden mit der Natur zu transportieren wären.
Der darauf folgende Umbau zur Brigantine oder Schonerbrigg – so nennt sich diese Takelung – war ein Kraftakt. Mit unzähligen Arbeitsstunden einer riesigen Zahl von Freiwilligen wurden unter anderem ein neuer Kiel eingebaut und 15 Tonnen Ballast im tiefsten Teil des Rumpfs untergebracht und nicht zuletzt die Maschine ausgebaut. Ins Rigg floss viel Knowhow aus Kanada ein von jenen Leuten, die nun in Costa Rica die «Ceiba» als Frachtsegel-Neubau vorantreiben. Unser Bootsmann und seine als Deckshand arbeitende Partnerin werden das Schiff in Kolumbien verlassen, um von dort nach Costa Rica zu reisen und eine Weile beim Bau der «Ceiba» mitzuarbeiten.
Das Ergebnis der wohl einer Viertelmillion Gratisarbeitsstunden ist die handlich zu segelnde «Tres Hombres»», die einerseits recht schnell anspringt, wenn der Wind auffrischt, aber auch gutmütig genug ist, dass man sie mit einer Mannschaft aus mehrheitlich Anfängern beherrschen kann.

Das Deck als «Wandtafel»: Der Erste Mate erklärt die Grundzüge der Astronavigation.
In der Flaute
Am 16. Dezember sind wir in Santa Cruz de la Palma in See gestochen für den grossen Sprung über den Atlantik. Wir hatten noch die Ankunft eines Trainees abwarten müssen und Kapitän Wiebe war beunruhigt, wir könnten in einer im Wetterbericht angekündigten zweiwöchigen Windstille hängen bleiben. Zeitweilig sah es dann auch so aus, als ob uns diese Geduldsprobe nicht erspart bleiben würde: 18. Dezember, 2.30 Uhr. Wir haben die Wache von Mitternacht bis 4 Uhr. Flaute. Die digitale Anzeige des GPS-Geschwindigkeitsmessers schwankt zwischen 0,3 und und 0,5 Knoten, die Segel flappen, wenn das Schiff in der Dünung rollt. Noch haben wir über 100 Seemeilen vor uns, bis wir den befreienden Passat erreichen, der uns über den Atlantik schieben soll. Ab und zu knarrt etwas im Rumpf, irgendwo schlackert ein Block. Sollte jetzt jemand über Bord gehen, könnte die Person schneller schwimmen als das Schiff. Manchmal ein Hauch auf der Wange, aber es bleibt unklar, ob da Bewegung in der Luft ist oder ob das nur vom Rollen des Schiffs kommt. Der Bildschirm des Laptops blendet in der Dunkelheit, und die Zahl der Tippfehler ist immens, da die Finger wegen der Bewegung des Schiffs ihr Ziel zu oft verfehlen. Hin und wieder dringt ein Lachen von achtern bis mittschiffs: Wenn man sich unterhält und Witze macht, geht die Wache schneller vorüber. Dann wieder Stille, die Wasseroberfläche spiegelt den Mond, der so weit oben steht, dass er keine Lichtstrasse mehr aufs Wasser legt.
Zwischendurch haben wir das Royal-Segel geborgen und wieder gesetzt, einfach nur zum Training und um die Schläfrigkeit abzuschütteln. Dann haben wir zusammen eine Scheibe Brot verdrückt. Bald ist drei Uhr. Jemand kocht in der Galley Tee und Kaffee für die nächste Wache. Gurgeln am Rumpf, dann flappt wieder ein Segel, dann das nächste, und eine alte Welle, die von weit entfernten Winden erzählt, rollt unter uns hindurch.
«Wie eine Familie»
Zum Glück ging es nicht so weiter: 26. Dezember, 1.15 Uhr. Wieder die Mitternachtswache. Die mag ich eigentlich ganz gern. Schlimm ist es dagegen oft, nach der Abendwache und nur dreieinhalb Stunden Schlaf für die Vieruhr-Wache geweckt zu werden. Da hatte ich gestern eine Stinklaune. Als wir nach dem Frühstück endlich in die Koje konnten, war ich gleich weg. Mittags wurden wir dann geweckt: Weihnachtsessen. Die Köchin hat ein festliches Dreigang-Menü hingekriegt, inklusive einer eigenen Variante für die Vegetarier. Dann die eigentliche Party, viel gelacht, etwas Wein getrunken.

Weihnachtsessen auf dem Atlantik.
Mittlerweile haben wir die Flautenzone überwunden und machen zwischen 5 und 8 Knoten. Teilweise sind die zusätzlichen Leesegel schon gesetzt, aber wenn es Tag wird, werden wir wohl noch mehr Tuch ins Rigg bringen. Die Fahrt ist herrlich, eine völlig andere Erfahrung als die Nordsee mit ihrer Kälte und den Regenschauern. Oft könnte man meinen, man segle auf einem Binnensee, konstanter Wind, zwischendurch fast keine Dünung, so ziehen wir dahin. Dies ist wohl der schönste Teil der ganzen Reise.
Die Gruppe der Trainees ist bunt. Da gibt es Leute, die sich eine Auszeit vom Berufsleben nehmen. Andere wollen sich klar werden, was nach dem Studium aus ihrem Leben werden soll. Viele haben eine kreative Ader und auch eine entsprechende Ausbildung. Doch bei allen ist klar, dass sie eine nachhaltige Form des Reisens suchen, dass sie Sorge zur Umwelt tragen und das Modell Fairtransport unterstützen wollen.
Das Leben an Bord ist in gewissen Aspekten fast mit einem Kloster zu vergleichen: Seit zwei Monaten keine Nachrichten mehr, kein Trump, kein Syrienkrieg, kein Erdogan, kein Putin, keine Kampfjet-Beschaffung, keine Migrationsdiskussionen, keine Unfälle und Verbrechen, keine People-Meldungen… Zu dieser Abgeschiedenheit des Meeres gesellen sich die spartanischen Bedingungen und die enge Struktur der Abläufe: Wache, Essen, Schlafen, Wache, Schlafen… Man kann sich nur eingeschränkt aussuchen, was man essen möchte. Es gibt, was es gibt.
Trotzdem ist das Leben locker. Im Kontrast zur «Alexander von Humboldt 2», die wir in Santa Cruz de La Palma besichtigen konnten und auf der man die Hierarchien der Funktionsgruppen offenbar strikt durchhält – etwa durch getrennte Aufenthaltsräume für Offiziere, Mannschaft und Trainees – hat unser Kapitän die Parole ausgegeben: «Lasst uns segeln wie eine Familie». Da machen die beiden Mates – «Offiziere» wäre hier ein völlig deplatzierter Ausdruck – oft die gleichen Jobs wie die Deckshands oder die Trainees. Und obschon wir sehr eng aufeinander leben, sind bisher nennenswerten Konflikte aufgetaucht.

Segeln auf der «Tres Hombres» heisst nicht zuletzt Arbeit: Schleifen und Ölen der Nagelbank.
Frachtsegeln ist nicht technologiefeindlich
Die Tres Hombres und Fairtransport setzen auf Low-Tech. Um aber die Seetransporte künftig unter Segeln durchzuführen, ist auch Hightech notwendig. So rechnet Jorne, einer der Gründer von Fairtransport auf seiner Website vor, dass die industrielle Produktion durch 3-D-Druck und künstliche Intelligenz in Zukunft wieder wesentlich lokaler werden könnte. Das übers Meer geschipperte Volumen werde somit sinken. Zudem seien bis 2050 die Transporte von Erdöl, Kohle und Gas, die bisher rund die Hälfte des Volumens ausmachen, weitgehend überflüssig, wenn die Menschheit bis dahin wirklich die Wirtschaft auf Null CO2-Emissionen umstellt.
Im Detail rechnet er vor, dass aktuell 50´732 Schiffe (2018) über 100 Bruttoregistertonnen unterwegs seien, die eine Gesamtkapazität von rund 1,9 Milliarden Tonnen aufweisen. Davon ist ein grosser Teil Überkapazität, viele Schiffe liegen irgendwo still und warten auf Fracht. Falls jedes Schiff seine Kapazitäten voll nutzen könnte, wäre nur ein Drittel der heutigen Flotte nötig.
Jorne kommt weiter zum Schluss, dass sich das notwendige Transportvolumen auf ein Neuntel senken liesse (zu den Details der Berechnungen siehe https://ecoclipper.org/News/replacing-motor-by-sail/). Dies lasse sich mit 130´000 Segelfrachtern verschiedener Grösse bewältigen. Diese erfordern reichlich Mannschaft, viele Werften für den Unterhalt, und nicht zuletzt mehr, dafür aber kleinere Häfen. Er betont, dass diese Berechnung auf vielen Annahmen beruht, dass die reale Entwicklung auch ganz anders verlaufen könne, dass man nicht wisse, ob weitere klimaschonende Technologien auf den Markt kommen und wie sich die Nachfrage durch sich verteuernde Transporte entwickle, welchen Wandel die Klimaveränderung mit sich bringe. Trotzdem zeige das Rechenbeispiel, dass man die Welt auch mit Segelschiffen beliefern könnte.
Natürlich gibt es Einwände, etwa die Kosten. Gegenargumente: Was kosten die Umweltschäden? Welchen Preis setzen wir für die Gehörschäden der Meeressäuger ein? Und nicht zuletzt: Der Klimawandel wird in jedem Fall teuer. Entweder man setzt das Geld für die Vermeidung von Katastrophe ein. Oder man muss es hinterher für die Bewältigung der Katastrophen ausgeben. Hier an Bord herrscht eher Pessimismus: Zu mächtig seien die Erdöllobby und anderen Interessengruppen, die am heutigen System festhalten wollen, da sei zu viel Geld im Spiel, meinen viele. Trotzdem: Zu Hause bleiben und nichts unternehmen kommt nicht in Frage.
Dabei ist klar: Auch der Transport unter Segeln belastet die Umwelt, wenn auch um mehrere Zehnerpotenzen weniger als der Transport mit fossil angetriebenen Schiffen. Da sind beispielsweise die Taue des laufenden Guts. Insgesamt erfüllen Seile von mehr als einem Kilometer Länge Funktionen im Rigg: Schoten, Fallen, Halsen, Gordinge, Geitaue und… und… und… Zwar achtet man auf der «Tres Hombres» darauf, dass die Bändsel, mit denen man vieles im Rigg befestigt, aus Naturmaterialien sind. Man verwendet aus Holz gekochten Teer und verdünnt ihn mit Terpentinöl das ebenfalls aus Holz gewonnen wird, um die gelaschten Stellen wetterfest zu machen oder die Drahtseile, welche die Masten stützen, vor dem Salzwasser zu schützen. Die Hölzer schützt man mit Leinöl. Und Werkzeug schützt man mit Schaf-Fett vor Flugrost anstatt mit fossilem Öl. Aber die ganzen Taue sind synthetisch. Und wenn sie sich abnutzen indem sie irgendwo scheuern– eines der grössten Probleme an Bord bei leichtem Wind auf Vorwindkurs –, dann weht der Wind die Fasern ins Meer: zukünftiger Mikroplastik. Man hat es zwar mit Tauen aus Naturfasern versucht, aber die recken sich zu stark. So kam es zu diesem Kompromiss. Es gilt also auch hier, was sich schon beim Strom zeigt: Wirklich umweltfreundlich ist nur der Strom, den man nicht verbraucht. Und 100 Prozent emissionsfrei ist einzig der Transport, auf den man ganz verzichtet.
Keine Ferien
Abgesehen von der Flaute kurz nach dem Start hatten wir auf dem Atlantik recht stetigen Wind. Zwar nehme der Passat mit der Klimaerwärmung etwas ab, meint Wiebe – dafür verlängert sich die Hurrikan-Saison – aber die Überquerung war das totale Kontrastprogramm zum Start in der spätherbstlichen Nordsee: keine kalten Füsse, auch nachts segeln im T-Shirt, mit Sandalen und in Shorts. Mit Ferien hat das alles aber nichts zu tun. Nachts dauern die Wachen vier, tagsüber sechs Stunden. Man ist also 12 Stunden am Tag eingespannt, wobei die Tages-Wachen vor allem dem Unterhalt des Schiffes gewidmet sind, wenn es an der Segelstellung nichts zu korrigieren gibt: Die obere Abdeckung der Reling und die Nagelbänke, auf denen die die vielen Taue das laufenden Guts belegt werden, abschleifen und ölen, rostige Platten im Schanzkleid durch hölzerne ersetzen, die Blöcke abschleifen und mit Leinöl behandeln… Da wird dann an Deck auch gehämmert und gesägt. Darunter im Rumpf suchen die Mitglieder der Freiwache nach Schlaf, denn nachts wird man oft ausgerechnet dann geweckt, wenn man die Tiefschlafphase erreicht hätte. Da sind Schlafmanko und Erschöpfung vorprogrammiert, selbst wenn es ab und zu die Möglichkeit gibt, eine Wache zugunsten einer Mütze voll Schlaf ausfallen zu lassen.
Nachdem ich die Schwierigkeit kritisiert habe, tagsüber den nachts verpassten Schlaf nachzuholen, hat mich der Kapitän aus dem Wachsystem rausgenommen. Ich mache nun also die beiden Tageswachen und bin damit beschäftigt, die Blöcke – das sind die Umlenkrollen für die Leinen – zu überholen. Gemäss einer vorläufigen Liste sind das rund 180 Stück. Zwar bin ich nach den zwölf Stunden auch müde. Aber dann stellt sich doch ein wohliges Feierabendgefühl ein, das mir bei den Wachen fehlte, weil man sich so schnell wie möglich in die Koje verzieht.
Das Schiff ist nur der sichtbare Teil
Viele Blöcke tragen Namensschilder, meistens von Einzelpersonen, teilweise von Paaren. Als beim Umbau oder oder bei der jährlichen Überholung das Geld ausging, hat man die Blöcke «verkauft», und die Namen der Spender segeln nun über die Nordsee und den Atlantik. Da zeigt sich: Das Schiff ist nur der sichtbare Teil und der Kristallisationspunkt. Das eigentliche Projekt besteht aus einem weitläufigen Beziehungsgeflecht, in dem die Arbeit «gegen Essen und Bett» bei der Überholung des Schiffs, das Fundraising, die Vermarktung der Ware und deren Einkauf organisiert werden. Daraus resultiert das «WG-Gefühl», das mir bereits bei meiner Ankunft in Den Heder aufgefallen ist. Dies zeigt sich auch in der täglichen Arbeit an Bord: Da werden auch die hölzernen Backkisten, in denen auf Deck die Taue verstaut sind, aufwendig und sorgfältig repariert. Müsste man diese Arbeitsstunden regulär bezahlen, bekäme jede Finanzchefin einen Herzinfarkt. Aber Reparieren und Im-Schuss-Halten anstatt Wegschmeissen und Neukaufen gehören eben zum sorgfältigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen – auch wenn mir nach wenigen Blöcken längst klar ist, dass dies definitiv nicht mein zukünftiges Hobby wird.
Dieses soziale Geflecht und die Arbeit aus Einsicht und Motivation ist vielleicht wichtiger als die reine Frage nach der Transport-Technologie «Segeln». Das Geschäftsmodell beruht nicht auf dem Gewinninteressen der Aktionäre und der Verpflichtung der Geschäftsleitung, diese Gewinne um jeden ökologischen Preis zu erwirtschaften, sondern auf Ideen, Idealen und Beziehungen. Könnte dies ein Aspekt einer demokratisch-klimaverträglichen Wirtschaft sein?
Hier zeigt sich auch ein Unterschied zum deutschen Frachtsegelschiff «Avontuur». Da schreibt Initiator Cornelius Bockermann: «Wie jedes Unternehmen haben wir, das heisst zum größten Teil ich persönlich, zum anderen über 100 Kleinanleger, in das Projekt investiert und erwarten nach einer angemessenen Zeit ausreichende Gewinnen zu generieren, sodass sich das Projekt damit finanziert.» Das Projekt «Avontuur» beruht also mehrheitlich auf dem Kapital einer Einzelperson, die es schafft, konservative Investoren wie den Milliardär aus der Medizinaltechnik-Branche an Bord zu holen. Geht es darum, angesichts der immer schneller sich aufschaukelnden Klimaüberhitzung möglichst bald einen substanziellen Anteil der Fracht unter Segel zu kriegen, ist dieses Modell vielleicht näher an der kapitalistischen Realität. Aber auf lange Sicht ist das Modell Fairtransport nachhaltiger.
Anstrengende Ankunft in Barbados
11. Januar 2020: Schon in der Badehose an Deck geklettert begrüssen mich die Spektralfarben eines Regenbogens, denn die aufgehende Sonne in den Wasserdampf über dem Meer zaubert. Dann folgt ein Sprung ins warme Wasser vor Bridgetown auf Barbados – welch ein Geburtstagsmorgen, welch ein Start ins AHV-Alter! Gestern Abend Kino an Deck auf einem kleinen Notebook-Bildschirm. Viel Kanonendonner der Breitseiten von Schiff zu Schiff während der napoleonischen Kriege zwischen England und Frankreich, in Segel eingenähte Gefallene, dramatischer Mastbruch im Sturm vor Kap Hoorn, kein Klischee zu abgedroschen für einen Seefahrts- und Kostüm-Streifen. Aber genossen auf Deck eines Schiffs, das unter Vollmond in der Dünung rollt, mit vielen Kommandos, die wir selbst aus der eignen Praxis an Bord Praxis kennen, war das dann halt doch ein spezielles Erlebnis.
Vorgestern sind wir hier vor Barbados angekommen. Das schon vor dem Frühstück so sauber wie selten gefahrene Ankermanöver wurde aber nicht belohnt: Der Anker hielt dem Winddruck in der Rahen nicht stand. Auch ein zweiter Anker half nicht, wir trieben ab. Also ging die Schufterei an der Ankerwinsch los. Wir schaffte es gerade noch, Segel zu setzen, und an einem verankerten Küstenmotorschiff vorbei zu kommen. «Das hätte das Ende der Tres Hombres sein können», meinte Kapitän Wiebe später. Dann kreuzten wir zurück zum Ankerplatz, wieder fiel der Anker, erneut hielt er nicht. Diesmal mussten wir nur einen Anker mit der schweren Kette hochwinden. Wieder Segeln gegen den Wind in der Atlantikdünung, die um die Insel herum schwappt. Diesmal versuchen wir es an einer anderen Stelle. Doch das GPS und die Peilung zu den Gebäuden am Ufer zeigen: Wir treiben erneut. Zum Fluchen sind wir schon zu erschöpft. Der Bootsmann gibt laufend weiter Kette nach, bis wir schliesslich kurz nach Mittag doch zum Stehen kommen. Nun liegen wir über einen Kilometer vom Ufer in der Karibischen See. Ununterbrochene Ankerwachen beobachten, ob der Anker wirklich hält. Uns blüht dann am Dienstag die Aufgabe, gegen 100 Meter dieser Kette wieder hochzuholen, um im Hafen die leeren Rumfässer zuerst aus- und dann am gleichen Tag gefüllt wieder zu laden.

Viele Blöcke tragen die Namen der Unterstützer der «Tres Hombres.
Dass wir nicht die einzigen mit diesem Problem waren, zeigte sich später, als ein grösserer Dreimaster mit Rahsegeln am Fockmast, zu driften begann. Diese Art des Riggs bietet dem Wind eben grosse Angriffsflächen, da «segelt» man auch mal unfreiwillig. Der grosse Unterschied: Die Dreimast-Barkentine fuhr einfach unter Motor gegen den Wind zum ursprünglichen Ankerplatz zurück: Manchmal ist es hart, konsequent ohne Motor zu segeln.
In der Neujahrsnacht hatte Wiebe eine Grussbotschaft von Andreas – dies war unser Kapitän bis Baiona – vorgelesen. Nach einem Rückblick auf die erste Atlantikfahrt – mit Hilfsgütern für das von einem Erdbeben schwer getroffene Haïti – schreibt er: «Du kletterst auf das Bugspriet, und diese eine Sternschnuppe war dafür gedacht, dass Du sie sehen sollst. Dein ganzes Leben kann sich in diesem Moment ändern, das Schiff gibt Dir den Raum dafür. Sie» – Schiffe sind immer weiblich – «und ihre kleine Schwester hören nur auf den Wind. (…) Und wenn alles gut geht mit unserer Revolution, werden sie bald wieder herrschen. Die Seeleute ohne Motor werden mit einem klaren Himmel und einem noch klareren Horizont belohnt.»
Der klare Himmel ist vorläufig nicht in Sicht: Küstenfrachter und vor allem Kreuzfahrtschiffe, welche die Stadt mehrmals täglich anlaufen, stossen nach wie vor Abgasfahnen aus, die schwere Zweifel wecken, ob die seit Neujahr geltenden schärferen Emissions-Vorschriften der UN-Schifffahrtsorganisation das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Die Kreuzfahrtschiffe erinnern zudem fatal an architektonisch übelste Vorstadt-Wohnblockgiganten, die sich aufs Meer verirrt haben. Da wird das letzte Quentchen Schiffs-Ähnlichkeit dem Profit geopfert.
Ein bisschen Segeltechnik
Dagegen haben die Wölbungen der Segel Künstler aller Zeiten zu immer neuen Bildern inspiriert. Dabei folgt das Segel uralten physikalischen Gesetzen, die heute auch das Fliegen ermöglichen. Der den Vögeln abgeschaute Flugzeugflügel ist immer nach oben gewölbt. Die Luft muss deshalb an der Oberseite einen längeren Weg zurücklegen als unten. Damit und durch den Anströmungs-Winkel entsteht unten ein Über- und oben ein Unterdruck, die das Flugzeug tragen. Reisst dagegen die Strömung ab, fällt das Flugzeug vom Himmel.
Ein Segel ist ein mehr oder weniger vertikal angeordneter Flügel. Der Segelmacher schneidet die Stoffbahnen so zu, dass nach dem Zusammennähen ein Bauch entsteht. Die optimale Wölbung des Bauchs und Stellung des Segels zum Wind erzeugt dann den Vortrieb. Unter Wasser funktioniert der entsprechend geformte Rumpf ebenfalls wie ein Flügel: Segelt man schräg gegen den Wind, driftet das Schiff leicht ab, der Kiel wird schräg von vorne angeströmt, was die nötige Kraft erzeugt, um nicht einfach quer davon zu treiben. Diesen Kurs nennt man „am Wind“.
Dagegen trifft die bei Journalisten beliebte Formulierung, eine Idee oder ein Projekt erhalte «Rückenwind», wenn sich die Verhältnisse günstig entwickeln, in der Praxis nicht zu: Die Segel werden bei Wind direkt von hinten nicht eindeutig umströmt. Das Schiff beginnt oft, stark um seine Längsachse zu rollen. Gefürchtet sind dabei auch Winddrehungen, bei denen das Grosssegel unkontrolliert von der einen auf die andere Seite übergehen kann – gefährlich fürs Schiff und die Mannschaft. Deswegen wird auf diesem Kurs auf traditionellen Schiffen wie der «Tres Hombres» der Grossbaum grundsätzlich mit einem Flaschenzug namens «Bullentalje» gesichert. Direkt vor dem Wind haben wir das Grosssegel sogar weggenommen, damit es nicht den weiter vorne liegenden Segeln den Wind wegnimmt. Und die Stagsegel auf dem Vorschiff arbeiten überhaupt nicht, da sie im Windschatten der Rahsegel liegen.
Günstiger ist dagegen Wind von der Seite oder schräg von hinten, ein Halb- oder Raumwindkurs: Die Segel werden umströmt, ziehen deshalb vorwärts und entwickeln auch eine Seitwärts-Kraft, die das Schiff stabilisiert. Man kann das Grosssegel wieder setzen und auch die an den Stagen zum Bugspriet laufenden Vorsegel können wieder ziehen.
Zudem haben wir die Rahen mit Rundhölzern verlängert und weitere Blöcke installiert um zusätzliche Segel zu setzen. Das Rigg wird dadurch noch komplexer. Entsprechend werden diese «Lee-Segel» nur hervorgeholt, wenn man lange mit der gleichen Segelstellung auf einem konstanten Kurs segelt, wie etwa bei einer Atlantiküberquerung. Bevor wir aber nach dreieinhalb Wochen wieder Land sehen, verschafft uns ein Ausflug mit dem Beiboot rings ums Schiff die Aussensicht. Und ein kurzer Sprung ins Wasser lässt uns ahnen, wie es ist, in einem fünf Kilometer tiefen «Bassin» zu schwimmen.

Socken und Hanschuhe trocknen im Sicherheitsnetz.
«Paradies und Hölle»
«Do need a hug?», fragt die Partnerin des Bootsmanns. Einen was? Sie deutet eine Umarmung an. Ja, die kann ich brauchen, und wie! Die Nachricht vom Tod eines Freunds in Basel hat mich getroffen. Und so haben die anderen mich mitfühlend aufgefangen. Auch das ist «Tres Hombres»: Lebensqualität durch Menschlichkeit, und die Erkenntnis, dass das Seemannsleben eben bedeutet, nicht zu Hause zu sein, wenn Wichtiges passiert.
«What the hell are you doing?», brüllt im Kontrast dazu der neue Kapitän Wiebe, als jemand beim Einlaufen in den Hafen von Santa Cruz zur falschen Zeit anfängt, das Einholen des Marssegels einzuleiten. Ja, es wird auch geschimpft, angetrieben und geflucht, wenn´s Spitz auf Spitz geht, wenn es einfach klappen MUSS – und viele halt Anfänger sind. Hinterher aber kein böses Wort, vielmehr Lob: «You have done a good job!»
«Bleibt aufmerksam»
Das Einlaufen unter Segeln in den Hafen war nicht einfach. Um dafür günstigen Wind abzuwarten haben wir den Weg künstlich verlängert und einen Tag zusätzlich auf See verbracht, denn die «Tres Hombres» ist keine Yacht mit kleinem Wendekreis, sondern reagiert gerade bei langsamer Fahrt nur träge aufs Ruder.
Bereits weit vor dem Hafen haben wir das Beiboot ausgesetzt. Es sollte eine drei Leute an Land bringen, die unsere Festmacher auffangen und über die Poller am Quai legen. Doch dann sehen wir weit weg das orange Schlauchboot in den Wellen schaukeln – der Motor hat ausgesetzt. Wiebe hatte zuvor die Schritte und Manöver seines Plans in einem «Master», einer Vollversammlung an Deck, erklärt. Allen inklusive Köchin hat er einen Posten und klare Aufgaben zugewiesen, dann aber auch gesagt: «Es kann vieles passieren, bleibt aufmerksam.» Und nun passiert es eben: Das Beiboot funktioniert immer noch nicht und wir ändern den Kurs, um es wieder aufzunehmen. Wie es hinterher weitergeht, wird man sehen. Solange wir auf See sind, lässt sich alles regeln und neu aufgleisen.
Doch dann springt der Motor im Dingi wieder an, sie rauschen ab Richtung Hafen. Wiebe verzichtet auf zwei im Plan angekündigte Manöver, zirkelt das Schiff um die Mole herum, und mit Hilfe des Beiboots legt er das Schiff an den für uns viel zu hohen Quai, der eigentlich für grosse Schiffe gebaut ist. Geschafft! Er verbirgt seine Erleichterung nicht.
Die «Tres Hombres» hat offenbar eine für die Hafeninfrastruktur schwierige Grösse: In Baiona lagen wir im Yachthafen und mussten befürchten, dass das schwere Schiff bei starkem Wind den Ponton oder die leichten Aluminiumpoller losreist. Und hier in La Palma liegen wir an einem Quai mit meterdick klobigen Gummipolstern für grosse Schiffe, wofür unsere eigenen Fender nicht geschaffen sind und wir mit Schweineschmalz – kein fossiles Fett! – schmieren müssen, damit sie die Farbe am Rumpf nicht wegreiben. Der Kapitän ordnet deshalb an, dass auch nachts die Mannschaft die Festmacher überwacht. Wie recht er damit hatte, zeigt sich am nächsten Morgen: Der Schwall eines einlaufenden Kreuzfahrtschiffs hat die Tres Hombres derart herumgeworfen, dass der oberschenkeldicke Balken, an dem unser Festmacher belegt war, zu Kleinholz zerbrach – die nächste Reparatur…

Da war der Schwall des Kreuzfahrtschiffs stärker als die Festmacherklampe der «Tres Hombres».
Frau über Bord
Tage zuvor: Schönes Wetter, wenig Wind und vor allem wenig Wellen. Ich versuche, an Deck zu schreiben, während die Backbordwache das Reffen übt. Die Wellen sind hier auf dem Atlantik faszinierende Gebirge, die zuerst den Blick auf den fernen Horizont versperren, sich beim Nähern manchmal wie eine schaumbedeckte Wand präsentieren und dann doch das Schiff wie mit einem Fahrstuhl in die Höhe heben, so dass sich einem in kürzester Zeit ein bis zwei Stockwerke höher der Blick des Meeres Weite öffnet, bevor man auf der Rückseite absinkt und sich die wandernde Wasserdüne von ihrer majestätischen Rückseite präsentiert und gemächlich Platz macht für die nächste ihrer unendlichen Kolleginnen.
Wellen können das Schiff aber auch hinterhältig hin und her werfen, und in ihrer Steilheit die brave «Tres Hombres» arg auf die Seite legen. Dabei ist ein im Vorschiff untergebrachter Mitsegler aus der Koje katapultiert worden und hat sich eine schmerzhafte Rückenprellung zugezogen. Und eine Trainee, die auf dem Achterschiff auf Wache war, ist über Bord geflogen. Dass sie vorschriftsgemäss ihren Lifebelt eingehakt hatte, rettete ihr das Leben, denn bei dem hohen Seegang, zumal nachts, ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden wiederzufinden, äusserst gering. So konnten die anderen sie wieder an Bord ziehen. Ich lag derzeit auf Freiwache in meiner Koje und kriegte die beiden vom gleichen Monster ausgelösten Unfällen erst beim Wachwechsel mit, als uns der merklich ernster gestimmte Kapitän informierte: «Manchmal ist der Ozean das Paradies, manchmal die Hölle.»
Lebens- und Todesraum
Den langen Aufenthalt in Baiona beendete Wiebe am gleichen Freitag, als wir die Fracht erhielten. Die 26 leeren Fässer mussten über die steile Steintreppe auf den Steg hinunter bugsiert und über diesen zu Schiff gerollt werden. Nun ist der Laderaum praktisch voll, und in Santa Cruz de La Palma werden einige mit Kanarischem Rum gefüllt. Dieser reift dann – von den Wellen in ständiger Bewegung gehalten – in den Fässern, in denen vorher Wein oder Spirituosen gelagert war. Dies ergibt dann für Spezialisten ein spezifisches Aroma – für mich eine fremde Welt, für Fairtransport ein wichtiger Geschäftszweig, mit dem das Hauptquartier in Den Helder mitfinanziert wird.
Mit dem etwas hektischen Schnellstart in Baiona wollte Wiebe – auf eine geänderte Wettervorhersage reagierend – günstige Winde ausnützen. Dies gelang, denn bei einem späteren Start hätten wir mit härteren Bedingungen rechnen müssen. Aber auch so war es für die neuen Trainees, die in Baiona an Bord kamen, ein steiler Einstieg, zumal sie teilweise noch nie gesegelt sind, sondern nur nach einer Form nachhaltigen Reisens suchen.
Der Atlantik kann aber auch anders. Am 4. Dezember hatten wir Sandalenwetter, während einer Nachtwache entdeckte ich an Deck einen fliegende Fisch, den eine barmherzige Mitseglerin rasch wieder ins Wasser beförderte – zur Enttäuschung der anderen, die ihn auch hätten sehen wollen. An zwei Tagen zogen wir je an einer grossen Schildkröte vorbei, und in der Nacht leuchten immer wieder kleine Punkte im Wasser auf, vor allem, wenn das Plankton an Deck gespült wird. Dann notlandete unvermittelt ein kleiner Vogel auf meiner Brust und hielt sich an einer Gurte des Sicherheitsgeschirrs fest – ein Fink, der anscheinend bei seinem Zug nach Afrika auf den Atlantik abgetrieben wurde und wohl in dieser Weite an Erschöpfung sterben wird. Bevor uns die Situation klar wurde, machte er sich schon wieder davon: Der Ozean ist Lebens- und Todesraum, nicht nur ein Medium für Transporte.
Im Hafen von Santa Cruz gibt es eine Gedenktafel für die «Pamir», ein kräftiges, schnelles Segelschiff, das mehrmals das stürmische Kap Horn umrundete und im letzten Jahrhundert hier Zuflucht vor Stürmen gesucht hatte. 1957 kenterte sie in einem Orkan im Atlantik, wohl wegen der schlecht gestauten Ladung argentinischer Gerste, die sich bei starker Krängung verschoben hatte. 80 Menschen kamen ums Leben, darunter viele noch nicht Zwanzigjährige, die als Lehrlinge an Bord waren. Da die reine Frachtfahrt kommerziell nicht mehr konkurrenzfähig war, hatte die Reederei die «Pamir» auch als Schulschiff betrieben. Die Katastrophe läutete das definitive Ende des transatlantischen Frachttransports durch Segelschiffe, bis dann ein rund halbes Jahrhundert später die «Tres Hombres» den Atlantik in der heutigen Umbruchzeit erneut unter den Kiel nahm.
Träger einer positiven Botschaft
Mittlerweile ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Zu Recht fordern die Jugendlichen an den Klimademos den «Systemchange». Da aber die sich immer schneller bestätigenden Vorhersagen kommender Katastrophen allein offenbar nicht ausreichen, den nötigen Wandel voranzutreiben, braucht es auch positive Visionen. Man kann an der «Tres Hombres» vieles kritik- oder merkwürdig finden: Das für Hafenmanöver unpraktische Fehlen eines Motors und die Notwendigkeit, aus dem gleichen Grund die Pläne der Willkür des Windes zu unterwerfen, sowohl was das Auslaufen als auch das Ankommen betrifft, machen das Konzept kaum alltagsfähig für die Logistikbranche.
So putzt man Muscheln, die man vom Hafenponton abgelesen hat, für die Muschelsuppe.
Aber der Verzicht auf einen Motor war ein politischer Entscheid: Seht her, es geht auch ohne fossile Treibstoffe! Lebensqualität durch gemeinsames Handeln statt durch materiellen Konsum. Arbeiten im Rhythmus der Natur, und nicht gegen sie oder über sie herrschend. Nicht zuletzt: Ist die Fixierung auf die Zeit, die bei uns dominiert wirklich der Weisheit letzter Schluss? In Afrika fährt der Bus erst los, wenn er voll ist: Energie-Effizienz vor Zeit-Effizienz. In Europa läuft alles nach Fahrplan, auch wenn der Bus leer ist. Das ist zwar praktisch. Aber setzt es uns nicht unter ungesunden Stress, wenn wir unsere Zeit- und Produktionspläne unabhängig davon umsetzen müssen, ob die Temperatur gegen 40 Grad steigt oder die Strassen vereist sind? Und was bedeutet die um ein paar Tage nicht genau planbare Ankunft der «Tres Hombres», wenn man dafür an Bord mehr Raum für Fracht und Menschen hat, da Motor und Tank keinen Platz wegnehmen? Zudem ist in der Frachtsegelei vieles ist noch im Fluss, entsteht erst durch die gesammelten Erfahrungen, entsprechend den Worten des spanischen Poeten Antonio Machado:
Wanderer, es gibt keinen Weg
der Weg entsteht beim Gehen
(Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.)
Den Kontrast vor Augen
«Inspiration, Meeresrauschen, Sonnenstrahlen, Glücksgefühle, Lebenslust.» Die Marketingleute des Kreuzfahrtschiffs, das uns die nächste Reparatur beschert hat, haben die menschlichen Bedürfnisse erkannt und sie in schwungvollen Lettern aussen auf Rumpf gemalt. Dem Schiff entströmen Menschen meines Alters – wohl alles rechtschaffene Leute, die nach dem Ende eines Arbeitslebens, das diesen Wünschen offenbar nicht gerecht wurde, diese sich nun an Bord des schwimmenden Konsumtempels zu erfüllen hoffen. AnimatorInnen mit Nummernschildern sammeln ihre Schäfchen, verfrachten sie in Busse oder auf Elektrovelos – da sind mir die stickige Koje, die blauen Flecken, die Übelkeit bei sich anbahnender Seekrankheit und der immer wieder unterbrochene Schlaf auf der «Tres Hombres» tausendmal lieber: Sie erfüllen die Versprechen auf dem Rumpf des Halbtotenschiffs wirklich. Unterhalten können wir uns selber und lachen uns kringelig wenn wir uns die Kommandos, Flüche und Kotzgeräusche eines fiktiven Bord-Papageis vorstellen

Dass man Glücksgefühle und Lebenslust durch materiellen Konsum erlangen könne – hier an Bord eines Kreuzfahrtschiffs –, ist eines der falschen Versprechen der sogenannten Marktwirtschaft.
Dabei sind wir ökologisch keineswegs frei von Widersprüchen: Die kleine Outdoor-Kamera, mit der ich unsere Abenteuer festhalte, trägt eine japanische Marke. Auf ihren Akku steht, die Zellen seien in Japan gefertigt, die Batterie dann in Vietnam zusammengesetzt worden. Aussen auf der Kamera prangt dann ein «Made in Indonesia». Allein für die Batterie waren also mehrere Seetransporte nötig. Was mit den übrigen Komponenten geschah, ist nicht ersichtlich. Meine Segelhose- und Jacke wurden in Vietnam produziert, mit Higtech-Stoffen, die garantiert nicht von dort sind. Die Segelkleider einer besonders renommierten Marke – sie trägt die Approbation der englischen Königin – kommen aus China. Auch die Mannschaft und die Trainees der Tres Hombres sind Teilnehmer des aktuellen Welthandels.
Von Äpfeln und Tomaten
Dieser nimmt absurde Formen an: «Gibt’s hier gar keine Früchte?» Doch: Kwabena führt mich auf dem Markt in Babile zu einer Frau, die ein paar Äpfel vor sich hingelegt hat. Babile ist ein Flecken im Nordwesten Ghanas, da wo die Satellitenaufnahmen auf Google Map nur eine schlechte Auflösung liefern, ab vom Schuss, auf Wikipedia unbekannt, kurz vor dem Ende der Welt, ausserhalb von nirgendwo… Zu dieser Jahreszeit ist die Savanne trocken, grau und braun. Und die Frau bietet keine Bananen aus dem fruchtbaren Süden Ghanas feil, keine Mangos, keine Ananas, nichts Einheimisches, sondern Golden Delicious aus Südafrika – den gleichen Apfel, den ich in Basel in jedem Supermarkt kaufen könnte, eine der wichtigsten Welthandels-Sorten.
Ob in Basel oder in Babile: Den grössten Teil des Weges legen die Äpfel im Schiff zurück. Das ist nicht nur schlecht: An der Nordseeküste habe ein Apfel aus Neuseeland den besseren CO2-Fussabdruck als ein Apfel, der mit dem Lastwagen vom Bodensee dahin transportiert und dann noch im Kühlhaus gelagert wurde, erklärt der Experte der deutschen Umweltorganisation Nabu am Telefon. Der Grund liegt in den immer grösseren Containerschiffen, welche mittlerweile über 20’000 TEU (20-Fuss-Container) laden können: Beim Schiffstransport ist der Treibstoffverbrauch und damit der CO2-Ausstoss pro Tonnen-Kilometer gegenüber anderen Transportformen am tiefsten.
Doch damit hat sich’s auch schon bezüglich Umweltfreundlichkeit. Seit der Ölkrise in den 70er-Jahren fahren die Schiffe mit Schweröl, einem teerähnlichen Abfallprodukt aus den Raffinerien. Die gute Nachricht: Die UN-Seefahrtsorganisation IMO schreibt vor, dass ab Januar 2020 der Schwefelgehalt im Treibstoff von 3,5 auf 0,5 Prozent sinken muss. Die schlechte Nachricht: Das ist immer noch 500 Mal mehr, als an Land erlaubt ist. Bei den anderen Schadstoffen wie beispielsweise den Stickoxiden – Katalysatoren sind auf See ein Fremdwort – und dem CO2 ändert sich nichts.
Natürlich lassen sich die rund elf Milliarden Tonnen, die jährlich über die Weltmeere verschifft werden, nicht mit Segelschiffen bewältigen. Vielmehr geht es darum, den Welthandel zu redimensionieren. «Es wird geschätzt, dass der konzerninterne Handel rund einen Drittel des grenzüberschreitenden Güteraustauschs ausmacht», bestätigt die Bank Crédit Suisse die Angaben auf meiner Fotobatterie. Da werden Halbfabrikate für jeweils weitere Verarbeitungsschritte verschifft, um Kostenvorteile und Lohndifferenzen auszunützen, was sich bei den extrem tiefen Frachtpreisen lohnt. Oft sind die Transporte auch direkt schädlich. So wird Kwabenas Mutter auf dem Markt in Babile ihre Tomaten nicht mehr los, obschon in Ghanas Küche Tomaten eine zentrale Rolle spielen. Gegen die Konkurrenz des Tomatenpürees aus Italien kommt die Kleinbäuerin nicht an. Dabei wurde das angeblich italienische Produkt mit Tomatenmus aus China oder Kalifornien produziert, das – wie könnte es anders sein – per Containerschiff nach Neapel verfrachtet wurde. Und die um ihre Existenz gebrachten ghanaischen Tomatenbauern enden dann oft als Erntesklaven in Europa, wenn sie die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer überleben.
Erbe der Kolonialzeit
Neben der Einbindung in den Weltmarkt gibt es einen weiteren Link zwischen Babile und der «Tres Hombres»: Wir segeln auf der klassischen Atlantikroute, der Passat heisst auf Englisch «Tradewind», Handelswind. Das ist der Kurs, auf dem damals auch die Sklavenschiffe fuhren, die aus Europa bunt bedruckte Stoffe, Schnaps und Gewehre nach Afrika brachten, diese dort gegen Sklaven tauschten und diese dann mit den Passatwinden über den Atlantik in die Karibik, nach Süd- und Nordamerika brachten, sie dort gegen die von Sklaven produzierten «Kolonialwaren» wie Zucker, Melasse, Rum und Baumwolle einhandelten, um diese dann gewinnbringend in Europa zu verkaufen. Ein Teil der Baumwolle wurde dann wieder zu jenem Stoff, den man in Westafrika gegen die nächsten Sklaven tauschte. Kwabenas Onkel ist Musiker und hat während einer Tournee in St. Louis in den USA Schwarze getroffen, die im gleichen Stil tanzen, wie man heute noch in Babile pflegt. Als man in Afrika die Arbeitskräfte noch gewaltsam raubte, statt sie wie heute als «Wirtschaftsflüchtlinge» abzuqualifizieren, sind die Vorfahren dieser Menschen wohl auf der gleichen Route entführt worden, auf der wir segeln werden.
Nachtrag am 13. Dezember
Gestern von der Mars-Rah gestürzt. Fast zwei Tage hatten wir gebraucht um rund einen Meter aufgescheuerte Naht am Marssegel von Hand zu nähen. Nun muss es wieder an der Rah angeschlagen werden. Ich war gerade dabei, es mit einem Flaschenzug etwas weiter nach Backbord zu ziehen, dann hing ich plötzlich kopfüber unter der Rah. An den Sturz kann ich mich nicht erinnern. Vermutlich schaltete das Hirn für Sekunden auf Reflex um – und damit den Rest total aus. Als das Bewusstein sich wieder einschaltete, hatte ich es geschafft, mich mit den Kniekehlen im Fusspferd – das ist ein Tau, auf dem man steht, wenn man an der Rah arbeitet – einzuhaken, und die Hände klammerten sich an jene Leine, an der auch mein Sicherheitsgeschirr eingehakt war. Paul, der Wachführer, dem ich auf der Rah zur Hand ging, rief laut um Hilfe, an Deck stoppten die Arbeiten, die gefüllten Rumfässer zu verladen, schlagartig. Rasch war der geschickteste Kletterer oben und half mir mit einer Technik, die er beim Felsklettern gelernt hatte, wieder auf die Rah. Butterweiche Knie. Langsam stieg ich ab, musste mich setzen.
Als zwei Stunden später eine Deckshand mitbekam, dass ich in der Nacht für zwei Stunden Wache eingeteilt war – die Festmacher müssen wir an dieser für uns ungünstigen Anlegestelle laufend im Auge behalten – meinte sie: «Bullshit, Du musst jetzt schlafen.» Sie verschwand und kam zehn Minuten später zurück, «du hast keine Wache»: Dies ist der Geist der «Tres Hombres», und geschlafen habe ich gut.

Die Tres Hombres wird von Hand beladen.
Der Ozean findet draussen statt
Ja, da gibt es die Stunden, in denen man sich fragt: Was mache ich hier? Weshalb tue ich mir das an? Nachts, wenn die Gummistiefel eine schier magnetische Anziehungskraft für Kälte entwickeln, die Finger in der Jackentasche keine Wärme finden und es auf die Kapuze prasselt. Leckt man sich die Lippen, erkennt man am Salz, ob das Wasser im Gesicht Regen oder Gischt ist. Das Schiff läuft, der Rudergänger hat alles im Griff, es gibts nichts anderes zu tun als da zu sein, für den Fall, dass plötzlich für ein Manöver viele Hände gefragt sind. Die Stunden schleichen, bis endlich die Backbordwache geweckt werden kann und für vier Stunden die Koje ruft.
Dann aber kommen die Momente des Glücks, wenn das Meer und die «Tres Hombres» ihre Reize auspacken: Nachts der Mondschimmer auf dem Wasser bei gutem Wind, der Sternenhimmel, die Milchstrasse, am Morgen noch eine noch ofenwarme Scheibe Rosinenbrot, tags eine neben dem Schiff auftauchende Orca-Rückenflosse, springende Delfine und wärmende Sonne. Ein Höhepunkt der Fahrt von Dieppe nach Baiona war ein Regenbogen in der Nacht. Wir schauten uns an, keiner wusste, dass es so etwas gibt oder hatte es jemals gesehen. Aber es war untrüglich ein Regenbogen, hellgrau vor dem Dunkel der dahinter liegenden Wolke. Mit etwas Phantasie konnte man einen Hauch Farbe erahnen, und hinterher diskutierten wir ergebnislos, ob das Mondlicht überhaupt Farben hat, die sich in den Regentropfen brechen könnten.
Dann wieder flucht man innerlich, wenn man quer durch die Galley (Küche) fliegt und unsanft an irgend etwas Hartem landet. Die Köchin stellte fest, sie sei mittlerweile von blauen Flecken übersät. Das Schiff hat drei Achsen: längs, quer und vertikal, und in seiner Auseinandersetzung mit Wellen und Wind bewegt es sich in der Regel um alle Achsen gleichzeitig. Da versuche man mal, sich unter Deck in einer Kabine von der Grösse eines halben Schlafwagenabteils umzuziehen. In der Koje geht´s nicht, weil der Raum zwischen Matraze und Decke gerade mal einen halben Meter beträgt. Im Sitzen geht´s auch nicht, da der Kollege in der unteren Koje schläft. Also raus. Der Versuch, da den Fuss in eine Hosenbein zu zirkeln kann rasch wieder mit innerem Fluchen enden…
Organisation statt Technik
Der Abschied von Dieppe fiel uns nicht schwer. Wir lagen etwas abseits der Stadt im lärmigen Industriehafen, der überstellt war mit Flügeln und Mast-Segmenten von Windkraftwerken, die von Spezialtransportern nach und nach abgeholt wurden. Gegen diese gigantischen Hightech-Teile wurde der Lowtech-Ansatz von Fairtransport besonders augenscheinlich: Die Kartons mit den Weinflaschen für Martinique reichten wir uns in einer Kette von Lieferwagen bis in den Laderaum der «Tres Hombres» weiter. Die Fässer wurden mit zwei Flaschenzügen – einer am Haupt, der andere am Vordermast befestigt – angehoben und dann durch kontrolliertes gleichzeitiges Fieren im Laderaum versenkt. Man kann eben fast alles entweder durch Technik – beispielsweise Containerkräne – oder durch soziale Organisation und Teamwork erledigen. Das eine ist unglaublich schnell, effizient und braucht viele Ressourcen, das andere erfordert kaum Material, dafür Erfahrungswissen und Koordination: umweltfreundlich und klimaneutral CO2-frei.
Dass dieser Transport unter Segeln den heutigen Anforderungen von Lieferungen «just in time» nicht entspricht, erlebten wir auf dem Weg nach Bayona hautnah: Zuerst sah es aus, dass wir am kommenden Abend hier einlaufen würden. Dann legte sich der Wind schlafen, drehte sich in seinen Träumen ein paar mal um, erhob sich zwischendurch mal kurz und legte sich dann mit ein paar Schnarchern aus der falschen Richtung wieder zur Ruhe. Also kreuzte die Tres Hombres gut einen Tag lang mit flappenden Segeln durch die bis zu vier Metern hohe Atlantikdünung. Auf dem Bildschirm, der die Route aufzeichnet, kreuzten sich die Linien unseres Kielwassers. Mal waren wir dem Ziel ein paar Seemeilen näher, dann wieder entfernter. Und das Einlaufen in die Bucht von Bayona war nach zwei Versuchen unter Segel nur mit Hilfe des Aussenborders am Dingi zu bewältigen: Der Wind liess das motorlose Schiff immer wieder im Stich.
Die «Tres Hombres» kann, wenn der Wind will
Dabei hatte die Tres Hombres auf der glatt verlaufenden Reise durch die berüchtigte Biskaya bewiesen, dass es möglich ist, Schiffe zu konstruieren, die schon bei mittlerem Wind nahe an ihre Rumpfgeschwindigkeit kommen. Für Verdrängerschiffe (das sind Frachter immer) ist die Rumpfgeschwindigkeit eine Art Schallmauer: Würde diese überschritten, müsste das Schiff die eigene Bugwelle hinaufklettern. Längere Schiffe sind prinzipiell schneller. Entsprechend konzipierte Segelfrachter könnten es deshalb punkto Geschwindigkeit mit den fossil angetriebenen Frachtern aufnehmen. Diese fahren unter dem Stichwort «Slow Steaming» derzeit oft nur langsam. Das spart einerseits Treibstoffkosten und hält andererseits die Schiffe trotz bestehender Überkapazitäten auf See. Übrigens waren vor gut hundert Jahren die von Hamburg nach Chile segelnden Salpeterschiffe schneller als die Dampfer auf der gleichen Route.
Hätte es immer so geweht, wären wir zwei Tage früher in Baiona angekommen.
Nicht zuletzt deshalb plant ein Mitgründer von Fairtransport den Bau eines grösseren – und damit schnelleren – Segelfrachters mit traditionellem Rigg (dazu mehr in einem späteren Blog-Beitrag). Dafür fehlt derzeit das Kapital. Fünf Millionen Euro sind zwar in einer Zeit, in der zu viel Geld auf dem Markt ist, das nach Anlagemöglichkeiten sucht, eigentlich ein Klacks. Aber die Investition in ein Projekt, das mit der Natur arbeitet, anstatt sie mit technischen Mitteln zu unterwerfen, scheint offenbar immer noch zu risikoreich.
Auf See sind solche Überlegungen aber weit weg. Plötzlich ist doch ein Manöver nötig, oft weil der Wind wieder einmal umgesprungen ist. Man sucht – vor allem im Dunkeln – nach den richtigen Leinen, und wenn´s dann darum geht, an den Brassen die Rahsegel auf den neuen Kurs auszurichten, brennen die Taue auf der vom Regen aufgeweichten Haut. Bei Wind kann das Knattern killender Segel und spritzende Gischt einen Hauch Dramatik in die Szenerie zaubern, und steht man im Lee unvermittelt in der aufs Deck schwappenden Welle, ist man doch noch froh über die vorher verfluchten Gummistiefel. Der Ozean findet eben auch in Zeiten der Digitalisierung immer noch draussen statt.

Entweder gute Stiefel oder nasse Füsse…
Glatte Hände
Im Hafen stellen wir dann fest, dass die Innenfläche der Hände ungewohnt glatt sind. Die Taue fühlen sich nicht nur an wie Schleifpapier, sondern wirken auch so. Auf der «Tres Hombres» gibts – ausser für die schwere Ankerkette – keine Winschen, alles ist Muskelkraft. Und wenns so richtig zur Sache geht, wird eben klar: Das Abenteuer ist analog, keine Kino, kein Netflix. Und greift dann bei Flaute und Sonne der eine oder andere zur Gitarre, sind die Finger steif. Da wird mir klar, weshalb die alten Blues-Gitarristen, die von körperlicher Arbeit lebten, vor allem einfache Licks entwickelten. Die virtuosen Soli kamen erst später, als es möglich wurde, von der Musik zu leben.
Hier in Baiona ist´s nun schon erheblich wärmer. Und beim Deck-Schrubben auf See fühlte sich das Wasser schon fast warm an. Die Thermo-Unterwäsche werde ich wohl auf dem Weg nach La Palma bald ganz wegpacken können bis zur Rückreise durch den Nordatlantik.
Der Anker rasselt mit tosender Kette in die Tiefe. Bis wir wissen, wo im Hafen wir festmachen können liegen wir auf Reede. Als der Kapitän nach der Fahrt im Dingi zu den Hafenbehörden Quarktorten zurückbringt, sind die langen Nachtwachen bald vergessen: Ankommen ist ebenso schön wie Segeln.
Nachtrag: Nun liegen wir schon ein paar Tage im Hafen, und schon macht sich Ungeduld breit, wann wir wieder lossegeln…

Bei Windstärke sieben empfiehlt es sich, die Sicherheitsgurte an den Lifelines einzuhaken.
Von Den Helder nach Dieppe
Goethe hatte recht: Saure Wochen – frohe Feste. Nicht dass die Reise lang gewesen wäre. Aber der heftige Start wurde für uns Neulinge teils doch zur Strapaze. Nun lädt Kapitän Andreas im Hafen von Dieppe zum Umtrunk. Plötzlich ist Käse da, dann eine französische Wurst. Rum sowieso, denn der gehört für Fairtransport ebenso zum Geschäftsmodell wie Kaffee aus Kolumbien oder Honig aus Spanien. Und am Montag – der 11. November ist in der Region ein Feiertag – kommen die Franzosen wieder und bringen neben einem Teil der Fracht allerlei Spezialitäten in flüssiger und fester Form mit. Das geflügelte Wort „wie Gott in Frankreich“ nimmt konkrete Gestalt an. Ansonsten zeigt sich Dieppe von der kalten Seite: Graupelschauer folgt auf Graupelschauer. Die Abfahrt aus Den Helder ist längst vergessen.
Aller Anfang ist seekrank
Rund ein halbes Hundert Personen hatte sich am Quai eingefunden, viele Umarmungen langes Winken, und dann die Schiffshörner, das Ablegen am Donnerstag war Emotion pur. Der Schlepper, der längsseits festgemacht hatte, manövrierte die Tres Hombres durch die Kanäle des Den Helder Hafens zur Schleuse, wo wir durch das „Tor zur Hölle“ („Hells deur“) die Nordsee erreichten. Andreas liess erste Segel schon im Hafen setzen, ruhig glitt das Schiff bei ablandigem Wind durchs Wasser.
Eigentlich hatte ich am Morgen festgestellt, dass ich meine Seekrankheits-Kautabletten nicht fand und mir rasch Ersatz in der Apotheke besorgt. Doch dann folgte Fehler auf Fehler: Der erste: In der Aufbruchstimmung vergass ich, die Tabletten zwei Stunden vor dem Ernstfall zu nehmen. Der zweite: Ich hätte noch schnell vor dem Ablegen die Blase leeren sollen. Diese meldete zunehmend Druck, als die See schon rauher und die „Tres Hombres“ schon ordentlich in Bewegung war. Also unter Deck im Kartenraum das Sicherheitsgeschirr und die Ölzeugjacke ausziehen und rein ins enge Klo. Geschlossene Räume sind Gift für jemanden, dessen Gleichgewichtssinn die Bewegungen des Schiffs noch nicht akzeptiert. Ab da war der Magen in Aufruhr und der Kopf auf Halbmast. Alles in die Ferne auf den Horizont schauen, was sonst als Mittel gegen Seekrankheit gilt, nützte nichts mehr. Die helfenden Tabletten waren unter Deck, sie in der Enge zu holen unmöglich. So hing ich bald in Lee auf dem Schanzkleid und fütterte die Fische mit der Bohnensuppe, die wir während der Schleppfahrt im Hafen noch schnell gegessen hatten.
Ich war nicht der einzige. Praktisch alle ausser den alten Profis erwischte es. Einzig in horizontaler Position war das Leben erträglich. Dabei kam ich noch glimpflich davon: Ab Freitag Mittag kehrten meine Lebensgeister zurück, anderen blieb der Genuss am Segeln länger verwehrt.
Ein wilder Ritt
Die Mannschaft und wir Trainees sind in zwei Hälften eingeteilt, die sich bei der Arbeit ablösen: Backbordwache und Steuerbordwache . Also folgt Wache auf Schlafen, wieder Wache, Schlafen, Wache… Schnell verliert sich das Zeitgefühl. Schon am Samstag schauten wir uns an und fragten, welcher Tag wir nun haben.
Die Nacht auf Samstag wurde ruppig. Sie hatten mich für meine Wache nicht geweckt. „Wir waren beschäftigt“, begründete dies Adam von der Stammcrew. Als ich an Deck komme, schlägt mir eine Bö ins Gesicht. In der Schwärze der Nacht stehe ich eher im Weg als nützlich zu sein. Dann graut die Dämmerung: Das Grossegel ist maximal gerefft, am Fockmast steht nur noch das Topsegel, und das Schiff prescht bei Windstärke sieben schaumschnaubend durch die Nordsee. „Zwölf Knoten“ strahlt Andreas. Immer wieder steigen Wellen unter dem Schanzkleid hindurch aufs Deck im Lee. In einer Welle kommen auf einen Schlag mehrere der an Deck gelaschten Kisten und Fässer, in denen Werkzeug und Tauwerk griffbereit verstaut ist, lose, und rutschen ins Lee. Andreas und François, bis zu den Knien in Schaum und Gischt, schaffen es, sie wieder festzubinden. „Das war eine herrliche Erfrischung“, meint der Franzose trocken, der es in all der Aktion schafft, nebenher in der Galley Brot für den nächsten Morgen zu backen. Meine Wache ist längst vorüber, aber es ist einfach zu schön, um jetzt schlafen zu gehen. Als der Wind abflaut, treibt mich die Novemberkälte dann doch in die Koje.
Volle Fahrt bei Windstärke sieben
Während der Nachmittagswache dümpeln wir dann in der Flaute im Zentrum des Tiefs, kriechen mit flappenden Segeln auf der Suche nach Wind durch die Dünung, machen dafür zeitweilig sogar Fahrt zurück nach Osten, wo dann am Abend endlich der Südwestwind die „Tres Hombres“ wieder in Fahrt bringt.
Mit der Sonne durch den Ärmelkanal
Kontrast am Sonntag Morgen: In der Nacht hat die Mannschaft es geschafft, am Hauptmast das Topsegel über der Gaffel zu setzen. Das war nicht einfach, denn nach Grundüberholung des Schiffs wurden beim Wiederaufbau des Riggs Leinen überkreuzt, die sich nicht kreuzen sollten, was dann auf See mit etlichem Aufwand zu beheben ist und trotz des hellen Mondlichts langes Leuchten mit der Taschenlampe ins Rigg erfordert. Als es endlich klappt, legt das Schiff fühlbar einen Zacken zu. In der Morgendämmerung erscheinen an Steuerbord die weissen Felsen von Dover, im Ärmelkanal herrscht reger Verkehr. Rot steigt die Sonne über den Horizont. Mit seitlichem Wind halb von hinten machen wir gut Fahrt. Im Gegensatz zu den Tagen zuvor, fällt der Wind nicht zusammen, sondern trägt uns stetig unserem ersten Ziel entgegen: Dieppe in Frankreich, wo wir Wein und Spirituosen für Martinique an Bord nehmen werden.

Auch im November kann sich die Nordsee mit Postkartenwetter präsentieren.
Den ganzen Tag wärmt die Sonne. Die nach aussen gestülpten Taschen der Jacke, die am Tag zuvor mit Regenwasser und Gischt klitschnass wurden, trocknen endlich. Die Gesichter werfen die Seekrankheitsschatten ab, die Köchin ist ins Reich der Lebendigen zurückgekehrt und die „Tres Hombres“ macht neun Knoten unter Vollzeug. Nicht zuletzt werde ich vor dem in die Koje kriechen erstmals nach diesen Tagen wieder mal die Zähne putzen. Und als in Reichweite der Küste einige Handys wieder Empfang haben, macht das Gerücht die Runde, auf Facebook gebe es rund fünfzig Fotos von unserer Abfahrt aus Den Helder.

Arbeit auf dem Bugspriet bei gutem Wetter
Interview mit dem Kapitän Andreas Lackner
Daniel Haller konnte bevor es hiess „Leinen los!“ mit dem Kapitän der Tres Hombres Andreas Lackner ein Interview führen zu Sinn und Zweck der Segelfrachtschifffahrt.

Bekanntschaft mit Leinöl und Wurzelteer
Ankunft in Den Helder am Abend, eine dicke Umarmung von der Köchin, der «Mutter» des Mannschaftshauses. In der privaten Bar der Reederei ist der erste Eindruck, in einer WG zu landen. Die meisten fläzen alle auf Brockenstuben-Sofas, viele noch in Arbeitsklamotten und Segelstiefeln, und schauen ausgerechnet den Schweizer Film „More than Honey“. Keine Untertitel, die schweizerdeutschen Teile muss ich übersetzen, verstehe aber wegen der Gespräche am Tresen selbst kaum etwas. Am Essenstisch dann rund 20 Leute. Ein Team-Mitglied hat Happy Birthday. Gesang laut und dissonant, aber herzlich.
Das Schiff ist noch nicht bereit, freiwillige Hände überall. Auslaufen werden wir mit ein paar Tagen Verspätung. Die Koje, die mir Kapitän Andreas Backbord Mittschiffs zuteilt, ist noch eine Baustelle, aufgerollte Kabel statt Matratze. Also logiere ich vorläufig im Mannschaftshaus. Viele fragen, ob ich arbeiten komme oder als Feriengast. Beides wäre legitim, aber um über das Schiff möglichst viel zu lernen will ich natürlich arbeiten.
Mani Matter fährt mit
«Uns spinnt’s!», geht mir durch den Kopf als ich das erste Mal vor der am Ausrüstungsquai liegenden „Tres Hombres“ stehe. Mit ihren 32 Meter Länge über alles wirkt sie kleiner als erwartet, verglichen mit den Container-Giganten geradezu niedlich. Und damit treten wir gegen die Materialschlacht auf See an?! Ja, uns spinnt’s im Sinn des Lieds von Mai Matter , in dem er die Arche Noah besingt: Da fängt einer an, irgendwo auf dem Trockenen ein Schiff zu bauen, nimmt Tiere und Nachkommen an Bord, und der Refrain ist jeweils: «Und me begryfft dass d’Lüt hei gseit: Däm Maa däm spinnts» (und man begreift, dass die Leute gesagt haben: Diesem Mann, dem spinnt’s) – bis die Zweifler dann alle ersaufen.
Der Sintflut-Mythos kommt weltweit in vielen Kulturen vor. Die Autoren der Bibel haben ihn aus älteren orientalischen Epen abgeschrieben, in denen die Götter die Menschen wegen deren schlechtem Lebenswandel mit einer grossen Flut vernichten wollen. Subtil singt Matter nicht „der Mann spinnt“, sondern „dem Mann spinnt’s“. Da gibt es also eine Instanz von aussen, die ihn zum vermeintlichen Spinner macht. In den alten Schriften ist dies ein göttlicher Whistleblower, der ihn vor den brutalen Plänen seiner Kumpane im Pantheon warnt.
Heute sind es keine rächenden Götter, die Naturkatastrophen organisieren, das schafft die Menschheit nun selber. Und die Warnung kommt nicht vom Himmel, sondern aus der Wissenschaft. Die Sintflut soll´s übrigens wirklich gegeben haben. Das heutige Schwarze Meer war ein Binnenmeer, das tiefer lag als das Mittelmeer. Als dieses wegen schmelzenden Gletschern am Ende er Eiszeit anstieg, brach es beim heutigen Bosporus durch und überschwemmte alles.
Schmelzende Gletscher – das ist wieder aktuell. Die „Tres Hombres“ ist aber keine Arche, kein Rettungsschiff für Hund und Katz, Mensch und Maus. Vielmehr sind es die Dimensionen, deretwegen die Leute von sagen könnten: „Denen spinnt’s.“ So ein kleines Schiff soll beweisen, dass sich Fracht auf See mit dem Wind transportieren lässt? 35 Kubikmeter emissionsfreier Laderaum – das entspricht einem 14-Quadratmeter-Zimmer, ist ein bisschen mehr als ein 20-Fuss-Container . Und damit wollen wir gegen die 11 Milliarden Tonnen angehen, die jährlich mit fossilen Treibstoffen übers Meer geschippert werden?
Aber eben: In den alten Geschichten behielt der Erbauer des Schiffs, ob er nun Noah oder sonstwie hiess, recht. Manchmal braucht´s Entscheide, die gegen die herrschende Vernunft oder die Vernunft der Herrschenden verstossen.
Da hatte der Bauch recht
In einer solchen Situation befinden wir uns heute. So berichtet die Norwegerin, mit der ich im Mast arbeite, dass aus ihrem Land Fisch in den Fernen Osten geschickt wird, um ihn dort mit Billiglöhnen zu verarbeiten. Anschliessend kommt er per Kühlcontainer wieder nach Norwegen zurück: Wo ist da die Vernunft?
Bei mir wars eher ein Bauch- statt ein Vernunftentscheid. Zur Arbeit am Denknetz-Jahrbuch und den Klimademos gesellten sich Jugend-Segel-Erinnerungen auf dem Bielersee. Alte Sehnsüchte brachen durch: Ich sagte zu, die ganze Rundreise ab Holland über den Atlantik in die Karibik und zurück mitzumachen. Recherchen zeigten dann, dass man die Idee, Fracht mit Wind statt fossiler Energie zu transportieren, breiter als erwartet diskutiert: Von einer EU-Arbeitsgruppe über Ingenieurbüros bis zu den konsequenten Frachtsegel-Organisationen, die vorläufig noch in Nischenmärkten agieren.
Nun steh ich also an Deck dieses Schiffs, das für ein halbes Jahr mein Zuhause wird. Und am Abend sagt der an den Händen haftende Geruch nach Leinöl und Wurzelteer: Der Bauch hatte recht!
Unzählige Details
So ein Schiff ist Organisation pur, eigentlich eher ein Organismus. Beispiel: Jede Bohle, mit welcher man den Frachtraum abdeckt, ist nummeriert und ein Buchstaben verlangt, dass die Nummer nach Backbord zeigen muss. Die Plane, die man darüber spannt, wird beidseitig mit Leisten gesichert, die man mit Keilen festklemmt. Auch da ist festgelegt, wie herum man die Keile einsetzen muss. So ist eine Unmenge Detail- und Erfahrungswissen gefragt – und dies mit einer Mannschaft, die zu rund zwei Dritteln aus Laien wie mir besteht. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich da bei den letzten Vorbereitungen dabei bin. So lerne ich eine Menge über die einzelnen Funktionen ohne dass es gleich ernst gilt. Und für die erste Etappe durch den Ärmelkanal und die Biskaya bis Spanien wird die Stamm-Mannschaft verstärkt, denn da kann es sein, dass man auch mal bei grober See ins Rigg klettern muss. „Easy sailing“, wie es ein Fairtrade-Crew-Mitglied nennt, kommt dann auf dem Atlantik im Nordostpassat.
An Bord ist das meiste Tauwerk etwas klebrig. Da ist der Wurzel-Teer, mit dem man die gewickelte Ummantelung der Stahlseil-Spleisse vor dem Salzwasser schützt, noch nicht ganz trocken. Und was aus Naturfaser ist, ist aus gleichem Grund mit Leinöl getränkt. Rittlings auf dem Bugspriet sitzend, unter mir das Wasser auf der einen und eine schwimmende Arbeitsplattform auf der anderen Seite, schneide ich mit einem Messer die „Marlings“ aus dem Vorjahr auf, jene straffe Verbindung aus Schnur, mit der man das Vorsegel an den Stagreitern festmacht. Dies sind auf diesem der Tradition verpflichteten Schiff geschmiedete Haken, auf einer Yacht wären es Karabiner. Die Marlings erweisen sich als erstaunlich zäh, das Leinöl hat sie eine ganze Saison im Schuss gehalten. Einer der Haken macht sich selbstständig und verschwindet mit einem „Plupp“ im Hafenwasser. Trotzdem kein Wort der Kritik, noch habe ich Anfängerbonus.
Das Anschlagen des Stagsegels erweist sich dann als recht aufwendig. Zudem schneide ich zuerst die Schüre für die neuen Marlings zu knapp ab, man hat zu kurze Enden, um sie wirklich fest zu zurren – wieder eine Erfahrung… Zum Glück hat der Australier, der als Freiwilliger beim Überholen des Schiffs mitarbeitet, ein besseres Auge und genug Schnüre mit aufs Bugspriet mitgenommen. Angesichts der vielfältigen Herkunft der Freiwilligen ist die Bordsprache Englisch in allerlei Varianten. Da werde ich das eine oder andere Mal dazu stehen müssen, rein sprachlich etwas nicht kapiert zu haben. Und habe ich das Messer am Schluss in die rote Kiste zurück gelegt? Ich weiss es nicht mehr. Schlecht!, denn so ein Schiff funktioniert nur durch Organisation.
Die Bewegung wächst
Ursprünglich war die „Tres Hombres“ der einzige unter Segeln fahrende Frachter auf großer Fahrt. Dabei unterstützte Fairtransport von Anfang an weitere Initiativen. Da ist zum Beispiel die „Avontuur“ aus Elsfleth . Deren Firmengründer Cornelius Bockermann machte sein Geld als Kapitän im Öltransportgeschäft und wurde dort vom Saulus zum Paulus. Heute propagiert seine Reederei Timbercoast „Eine Zukunft für sauberen Seetransport“ und „Aufmerksamkeit schaffen für die Umweltzerstörung durch die Schifffahrtsindustrie“. Ein Dokumentarfilm des Norddeutschen Rundfunks spricht aber von finanziellen Engpässen. In der Tat ist die Frachtsegelei nicht so lukrativ wie es das mediale Interesse an traditionellen Schiffen vermuten lässt: So musste der Kapitän der „Undine“, ebenfalls ein gestandener Schiffsoffizier, der unter Segeln einen Liniendienst zwischen Hamburg und Sylt betrieb, aufgeben und die Undine liegt nun im Museumshafen Övelgönne in Hamburg. Auf Anfrage betont Bockermann: „Da wir uns alle Erfahrungen mit Häfen, Lieferanten und diesem bisher wenig erschlossenen Markt selbst erarbeiten müssen, ist die Entwicklung langsamer als geplant, so dass wir die Finanzierung etwas aufstocken mussten.“
Das Schicksal der „Undine“ blieb der „Avontuur“ aber erspart: Der NDR-Bericht zeigt, wie Georg Näder, ein Milliardär aus der Medizinaltechnik Anteile an der „Avontuur“ zeichnet und Darlehen zu banküblichen Konditionen gewährt.“ Näder ist unter anderem auch bekannt als Spender von Summen in sechsstelliger Höhe für die deutsche FDP und die CDU. Die Idee des emissionsfreien Seetransports unter Segeln findet also keineswegs nur in der linksgrünen Ecke Anhänger.
Fairer Transport als Kritik am Welthandel
Entsprechend dürften die Diskussionen in der „Sail Cargo Alliance“ , einem Dachverband der Frachtsegler-Bewegung, unterschiedliche Positionen aufeinander prallen. So betont Andreas Lackner, einer der Mitgründer des Frachtsegelpioniers Fairtransport in einem „Spiegel“-Interview auf die Frage, ob die „Tres Hombres“ ein wirtschaftliches Unternehmen oder ein politisches Projekt sei: „In erster Linie ist es politisch. Wirtschaftlich ist die Sache insofern, als dass davon Leute leben müssen.“ Dann ergänzt er bezüglich des aktuellen Welthandels: „In unseren Augen ist es einfach unnötig, alles jederzeit und zum Tiefstpreis verfügbar zu haben, und das auf Kosten von zwei Dritteln der Weltbevölkerung, denen man die Ressourcen wegnimmt.“ Da setzt sich sein früheres Engagement als Greenpeace-Aktivist fort: Die Kritik an den Wurzeln der Probleme, dem überdimensionierten Welthandel . Diese Radikalität zeigt sich auch in den Schiffen: Sowohl die „Tres Hombres“ als auch die „Nordlys“ von Fairtransport fahren ohne Hilfsmotor. Und auch der als „EcoClipper“ geplante Neubau mit traditionellem Rigg, den Fairtransport-Mitgründer initiieren, ist ohne Motor geplant, aber größer, dadurch schneller und mit mehr Frachtraum.
Zu den Kunden der „Avontuur“ gehört Teikei, eine Bewegung, in der die Konsumenten direkt mit den Bauern zusammenarbeiten und auch deren Risiken mittragen. Gesegelten Kaffee aus einem mexikanischen Kleinbauernprojekt gibts mittlerweile auch in der Schweiz. Und auch bei Fairtransport liegt mittlerweile eine erste Anfrage eines Schweizer Importeurs vor.
Auch sonst segelt die «Tres Hombres» nicht mehr allein, sondern ermutigt andere, es ihr gleich zu tun. So chartert die in der Bretagne angesiedelte Trans Oceanic Wind Transport (TOWT) bestehende Segelschiffe, um Fracht zu transportieren und hat regional auch in Supermärkten ein Label für gesegelte Waren etabliert. Die britische Grayhound Lugger Sailing transportiert Biowein über den Ärmelkanal. In Italien bauen Idealisten an der „Brigantes“, die in Zukunft mit deutlich mehr Frachtkapazität als die „Tres Hombres“ unter Segeln Südamerika mit Europa verbinden soll. Ein Teil der Freiwilligen, die jetzt noch an der Überholung der „Tres Hombres“ mitarbeiten, reisen anschließend nach Sizilien zur „Brigantes“. Auch Andreas Lackner stellt den Sizilianern sein Knowhow zur Verfügung. Noch ist die Szene überschaubar, Fachleute sind rar und die Erfahrungen der «Tres Hombres» gefragt.
In Costa Rica baut die kanadische Organisation Sailcargo die „Ceiba“ ganz aus Holz, denn dieses speichert – im Gegensatz zu Stahl – CO2. Die Batterien für den elektrischen Hilfsmotor werden solar und durch einen sogenannten Schleppgenerator aufgeladen: Fährt das Schiff unter Segeln, treibt die Strömung über zwei Propeller den Generator an. Inspiriert ist das Projekt durch die „Tres Hombres“, an der die Kanadier mitgearbeitet haben und deren Idee und Botschaft Sailcargo mit der „Ceiba“ auf den Pazifik tragen wird. Fazit: Auch wenn aus Sicht der heutigen Logistikbranche der Transport unter Segeln als chancenlos gilt und die Fairtransport-Gründer zuerst als verrückt betrachtet wurden: Die „Tres Hombres“ transportiert ihre Fracht seit 10 Jahren und die von ihr initiierte Bewegung wächst.

Unter Segeln gegen die Klima-Überhitzung: Schiffsjunge im Renten-Alter
Geht am 4. November die Vernissage des Denknetz-Jahrbuchs über die Bühne, werde ich – sofern es den Windgöttern gefällt – schon keinen festen Boden mehr unter den Füssen haben. Am gleichen Tag sticht der motorlose Frachtsegler «Tres Hombres» in Den Helder in See. Über den Atlantik in die Karibik, immer da entlang, wo es Fracht gibt, die nicht nur bio und fair hergestellt wird, sondern auch ohne Treibhausgas-Emissionen transportiert werden soll. Anfang Juni werden wir dann wieder in Amsterdam einlaufen. Meine Rolle an Bord ist als «Trainee» umschrieben: Lehrling, Praktikant, Volontär, Schiffsjunge. Mein offizielles AHV-Alter wird mich auf dem Atlantik ereilen.
Dreckschleudern auf Hochsee
Dass ich als zahlender Lehrling mitsegle, hat viel mit der Fachgruppe «Welthandel und Umwelt» zu tun, die für das Jahrbuch verantwortlich zeichnet: Da lernte ich, dass der Welthandel für rund 26 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, die Produktion von Welthandelsgütern, Landnutzungsänderungen, Waldabholzung, Transport etc. eingeschlossen. Der maritime Transport, unbestritten pro Tonnenkilometer die klimafreundlichste Transportform, ist dabei «nur» mit zwischen 2 und 3 Prozent des Klimagas-Ausstosses beteiligt, also rund einem Zehntel der vom Welthandel verursachten Treibhausgase. Je nach Quelle ist es auch mehr, je nachdem wie man die Klimaschäden der Stickoxide – auf See sind Katalysatoren ein Fremdwort – oder die ausgestossenen Schwefeldioxide und andere Schadstoffe in CO2-umrechnet. Und nicht zuletzt ist die Schifffahrt das Rückgrat des Welthandels, indem sie rund 90 Prozent der gehandelten Güter transportiert. Wären die fossilen Seefrachtpreise nicht so unverschämt tief , käme dann wirklich noch jemand auf die Idee, zwecks Anbau von Futterpflanzen für die europäische Massentierhaltung den Regenwald in Südamerika zu verbrennen?
Wäre die Schifffahrt ein Land, stünde sie als CO2-Ausstösser an sechster Stelle noch vor Deutschland. Sie ist aber – wie die Luftfahrt – nicht im Klimaabkommen von Paris enthalten. Die zaghaften und teilweise untauglichen Versuche, den CO2-Fussabdruck der Seefahrt zu senken, werden von der Zunahme des Welthandels mehr als zunichte gemacht: «Laut der 3. Treibhausgas-Studie der internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) werden die Emissionen des Schiffsverkehrs bis 2050 (…) um 50 Prozent bis 250 Prozent steigen», schreibt das Deutsche Bundesumweltamt. «Wenn der Rest der Welt auf dem Weg in Richtung des 2-Grad-Ziels ist, würde dies zu einer Erhöhung des Anteils an den weltweiten Emissionen vom derzeitigen Niveau von 2 auf 10 Prozent führen.»
Richtige Analyse – falscher Schluss
Dabei müsste man spätestens 2050 bei wirklich Null Treibhausgas-Emissionen angelangt sein: «Was bisher in der Politik nicht verstanden und worüber oft geschwiegen wird, ist der ernüchternde Befund des wissenschaftlichen Konsensus: Eine signifikante Reduktion des globalen CO2-Ausstosses kann den Klimawandel bestenfalls verzögern, jedoch nicht stoppen. Selbst die Halbierung des globalen CO2-Ausstosses bringt keine Lösung. Nur der rasche Übergang zu einer vollständig dekarbonisierten Energieversorgung stoppt die Erderwärmung.» Dies schreibt keine Klimastreik-Aktionistin, kein grüner Schwarzmaler, sondern der Chief Investor Officer der Bank Cler. Seine Folgerung: «Es ist ein radikales Szenario für die Absenkung des Ausstosses notwendig.» Die Konsequenz, welche der Banker daraus zieht, ist allerdings nicht radikal, sondern resignativ: «Wir gehen nicht davon aus, dass eine Begrenzung der Klimaerwärmung wahrscheinlich ist.» Also gibt man klein bei: «Die Kosten zur Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen sind ein Risiko (…), aber auch eine Chance für jene Unternehmen und Investoren, die Lösungen und Visionen entwickeln, damit die Welt wenigstens besser mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel umgehen kann.» Mit anderen Worten: Unterwerfen sich die Politiker zu stark der kurzfristigen Profitlogik um radikale – das heisst wörtlich «an die Wurzel gehende» – Massnahmen durchzusetzen, dann muss man halt die Geschäfte mit den daraus resultierenden Katastrophen machen…
Seit zehn Jahren emissionsfrei
Damit sitzt die Bank auf dem falschen Dampfer. Die holländische Reederei Fairtransport B.V. mit ihrem Anspruch, Waren zu 99 Prozent emissionsfrei zu transportieren, setzt dagegen auf den richtigen Segler: Seit zehn Jahren fahren die «Tres Hombres» und ein weiteres Fracht-Segelschiff unter ihrer Flagge, transportieren Bio-Fairtrade-Ware über den Atlantik, zwischen Karibikhäfen und an den Nordseeküsten. Zwar sind die 45 Tonnen, welche die «Tres Hombres» laden kann, nicht einmal die doppelte Nutzlast eines 40-Tonnen-Lastwagens. Verglichen mit der «MSC Gülsün» der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC, Genf), die 23’756 TEU (20-Fuss-Container) laden kann , ist dies eine höchstens symbolische Menge.
Die «Gülsün» ist aktuell der grösste Container-Transporter. Die immer gigantischen Schiffe sind einer der Versuche, den CO2-Fussabdruck des maritimen Transports zu senken. Pro Tonnenkilometer wird dieses Ziel in der Grössenordnung einiger Prozente erreicht. Da aber gleichzeitig die Kosten und damit die Frachtpreise sinken, führt dies tendenziell auch zu einer Mengen-Ausweitung – der klassische Rebound-Effekt. Entsprechend ist die Botschaft der «Tres Hombres» wichtiger als ihre Transportleistung: Emissionsfreier Transport ist möglich und notwendig!
Wie dies in der Praxis funktioniert, wird Thema dieses Blogs buchstäblich «vom Schiff aus» sein. Mit ergänzenden Texten wird die Fachgruppe Welthandel und Umwelt an Land einzelne Aspekte vertiefen. Wir hoffen, damit nicht zuletzt den Blick auf die klimapolitisch erforderliche Redimensionierung des Welthandels zu lenken: Sind Freihandelsabkommen wirklich Wohlstandsmotoren? Oder sind sie nicht vielmehr – unter anderem – ein Klimakiller?
Daniel Haller am 24. Oktober 2019.
Neu
15. Juni 2020: In Amsterdam zeigt sich, dass die «Tres Hombres» auf viel Sympathie zählen kann
05. März 2020: Gegen den Wind von Santa Marta nach Boca Chica
22. Februar 2020: Von Martinique auf die Gewürzinsel Grenada
29. Januar 2020: Von Barbados nach Martinique
24. Dezember 2019: Letzte Station vor der Fahrt über den Atlantik
19. Dezember 2019: Von Dieppe nach Baiona mit Hindernissen
25. November 2019: Von Den Helder nach Dieppe
16. November 2019: Interview mit dem Kapitän, Andreas Lackner
09. November 2019: Bekanntschaft mit Leinöl und Wurzelteer
24. Oktober 2019: Unter Segeln gegen die Klima-Überhitzung: Schiffsjunge im Renten-Alter
Tiefe
Folgende Texte bieten wir vertiefend zum Blog von Daniel Haller an:
Xenia Karametaxas: Internationale Standards in der Seeschifffahrt zur Reduktion von CO2 Emissionen
Julian Bieri: Weltweite Lohnunterschiede und kritische Analyse politischer Gegenmassnahmen
Bettina Dyttrich: Thesen zur Agrarökologie in der Schweiz und darüber hinaus
Barbara Unmüssig: Die Grenzen der Grünen Ökonomie
Stefan Kessler: Land Grabbing – der neue Neo-Kolonialismus
Stefan Sipp: Die Gute Seemannschaft
Ueli Gähler: Kanarische Inseln und kapitalistisches Weltsystem – ein historischer Rückblick
Ueli Kasser: Windunterstützung – eine Perspektive fürs Klima
Helen Müri: Welche Rolle kann fairer Gütertransport spielen?
Zur Person
Es bloggt Daniel Haller. Er hat frisch zur Pensionierung als Schiffsjunge auf dem Segelfrachtschiff „Tres Hombres“ angeheuert. Daniel Haller war Drittweltladen-Gründer in Hamburg, Erwachsenenbildner im Bereich Bauerngewerkschaften in Bolivien, politisierter Kochbuchautor. Er studierte hispanoamerikanische
Literaturwissenschaft und arbeitete dann als Tageszeitungsredaktor in der Schweiz.
Ziel
Das Denknetz-Jahrbuch 2019 zeigt, dass bereits das heutige Ausmass der globalen Güterströme die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten gefährdet. Das prognostizierte Wachstum bis ins Jahr 2050 ist erst recht nicht klimaverträglich. Fossil angetriebene Frachtschiffe transportieren gegen 90 Prozent dieser Warenströme. Sie stossen schon heute mehr Klimagase aus als Deutschland. Die Schweiz ist einerseits Sitz von Konzernen, über die ein Fünftel des Welthandels läuft, und andererseits von Dutzenden Reedereien, darunter mit MSC der zweitgrössten der Welt. Sie ist also auch als Binnenland dafür mit verantwortlich, was auf dem Meer passiert. Das fehlt bisher in der politischen Diskussion. Der Blog über ein Frachtsegelschiff soll dies ins Blickfeld rücken und Alternativen diskutieren.